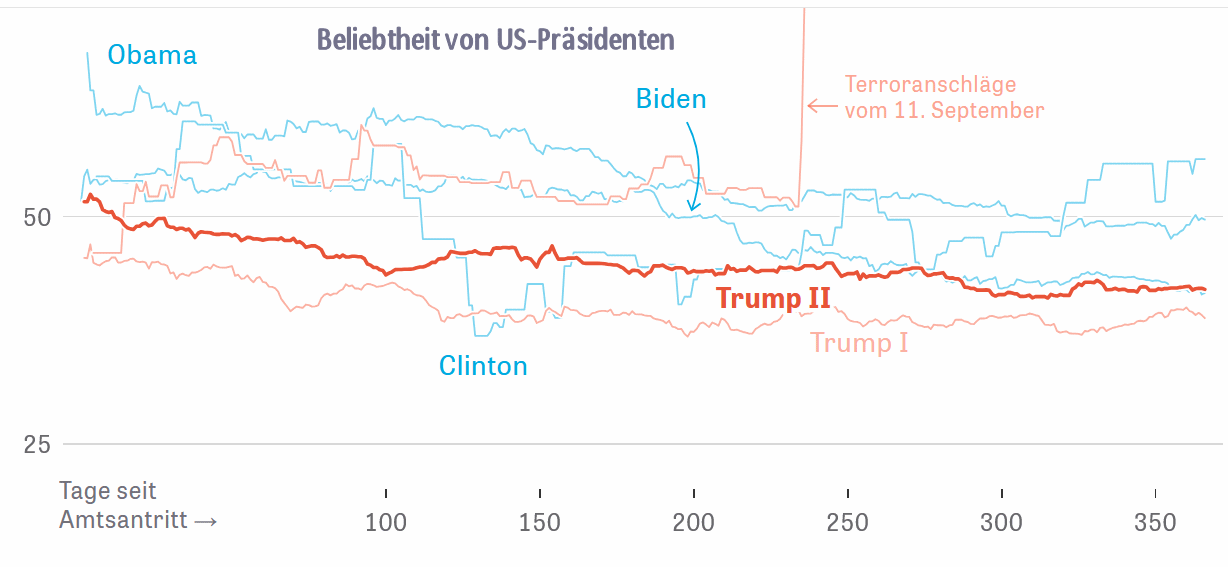
Dr. Joachim Jahnke - Die letzten Blog-Einträge
(1486) Schon 1,8 Millionen verwundete oder tote Soldaten von beiden Seiten in der Ukraine
(1485) Oxfam-Studie: Wie Superreiche die Demokratie zerstören
(1484) Trump, der unbeliebteste Präsident der USA
(1483) Menschenrechtsorganisation geht von mindestens 2.500 Toten unter den Aufständigen im Iran aus
(1481) Altersarmut: Mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen als je zuvor
(1428) Palästinenser werfen Israel weitere Angriffe auf Gazastreifen vor
Blog 1487 30-01-26: Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar mit über drei Millionen auf den höchsten Stand seit fast zwölf Jahren
Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Januar mit über drei Millionen auf den höchsten Stand seit fast zwölf Jahren gestiegen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) registrierte 3,085 Millionen Menschen ohne Job, wie die Behörde am Freitag mitteilte. Das waren 177.000 mehr als im Dezember und 92.000 mehr als vor einem Jahr. ?Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,4 Punkte auf 6,6 Prozent. Noch höher war die Arbeitslosenzahl zuletzt im Februar 2014 mit rund 3,138 Millionen.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1486 28-01-26: Schon 1,8 Millionen verwundete oder tote Soldaten von beiden Seiten in der Ukraine
Die russische Armee hat nach Berechnungen von US-Experten in den fast vier Jahren Angriffskrieg gegen die Ukraine 1,2 Millionen Soldaten durch Verwundung oder Tod verloren. Ein Bericht der Denkfabrik CSIS in Washington geht dabei von 325.000 getöteten russischen Soldaten seit Februar 2022 aus. Für die Ukraine werden die Verluste auf 500.000 bis 600.000 Soldaten beziffert, darunter 100.000 bis 140.000 Tote.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1485 23-01-26: Oxfam-Studie: Wie Superreiche die Demokratie zerstören
Extreme Ungleichheit: Die zwölf reichsten Menschen der Welt besitzen heute mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen.
Während sich in Davos im Januar die Mächtigen der Welt zum Weltwirtschaftsforum versammeln, legt die neue Oxfam-Studie den Finger in eine der offenen Wunden unserer globalen Ordnung. Hinter den wohlfeilen Schlagworten vieler Wirtschaftslenker und Politiker - "Resilienz", "Nachhaltigkeit" und "inklusive Wirtschaft" verbirgt sich eine Realität, die immer grotesker wird: Vermögen konzentriert sich in einem historischen Ausmaß bei wenigen Menschen - und die Politik schaut weg. Dies hat enorme Kosten für Wirtschaft und Gesellschaft und ist heute eine der größten Bedrohungen für unsere Demokratie. Die Fakten sind erschütternd. In den vergangenen fünf Jahren - und besonders im letzten Jahr - ist die Vermögensungleichheit weltweit massiv gestiegen. Die zwölf reichsten Menschen der Welt besitzen heute mehr Vermögen als die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung zusammen. Die Vermögen der Milliardäre sind in fünf Jahren um 80 Prozent gewachsen, allein im letzten Jahr um 16 Prozent. Das ist keine normale Marktdynamik mehr, sondern eine strukturelle Schieflage. Besonders drastisch zeigt sich das am Beispiel Elon Musk: Er verdient laut Oxfam-Studie in vier Sekunden mehr als ein durchschnittlicher Mensch im Jahr. Gleichzeitig hat er sich bei Tesla ein Vergütungspaket ausgehandelt, das ihm perspektivisch fast eine Billion Dollar zusätzlich verschaffen könnte - eine Zahl jenseits menschlicher Vorstellungskraft. Und Musks Äußerungen lassen kaum Zweifel, dass es ihm dabei nicht primär ums Geld geht, sondern um Macht und Kontrolle. Genau hier wird das politische Problem sichtbar. Auch Deutschland ist kein Hort der Gleichheit. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin zeigt seit Jahren: Die reichsten ein Prozent besitzen mehr als 30 Prozent des gesamten Vermögens, während das ärmste Drittel praktisch keine nennenswerten Ersparnisse hat. Im europäischen Vergleich gehört Deutschland zu den Ländern mit der höchsten Vermögensungleichheit - nicht nur mit viel konzentriertem Reichtum, sondern auch mit viel Armut. Mit knapp einem Drittel aller Menschen lebt hierzulande ein ungewöhnlich großer Teil der Bevölkerung ohne Rücklagen und ist damit abhängig vom Sozialstaat. Gibt es nicht in jeder Gesellschaft Ungleichheit? Ja, Ungleichheit existiert überall. Und in einem gewissen Maß kann sie sogar echte Leistung und freie Entscheidungen widerspiegeln und somit Anreize setzen. Das Problem ist: Der größte Teil der heutigen Vermögensungleichheit hat wenig mit persönlicher Leistung zu tun. Er beruht immer stärker auf Erbschaften, politischem Einfluss und der Fähigkeit, Wettbewerb zu verzerren und Steuern zu vermeiden. Wir erleben keine Meritokratie, sondern eine Vererbungsgesellschaft mit Tendenzen zur Oligarchisierung. Hohe Ungleichheit zerstört Solidarität. Sie schafft eine Gesellschaft der Gewinner und Abgehängten. Viele Eltern können ihren Kindern nicht das ermöglichen, was längst als normal gilt - Musikunterricht, Auslandsaufenthalte, Nachhilfe, kulturelle Teilhabe. Damit werden Lebenswege schon früh festgelegt. Polarisierung und Misstrauen wachsen, während das Gefühl gemeinsamer Zugehörigkeit schwindet. Wirtschaftlich ist Ungleichheit kein Motor, sondern eine Bremse. Wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft wenig Chancen haben, gehen Talente verloren - für sie selbst und für die gesamte Volkswirtschaft. Unternehmen verlieren Kreativität und Produktivität, weil Fachkräfte fehlen oder diese weniger Fähigkeiten haben, als es möglich wäre. Politisch ist die Lage gefährlich. Geld kauft Macht - das sehen wir gerade in den USA, aber auch zunehmend in Europa. Auch in Deutschland haben sehr reiche Familienunternehmen und Superreiche erheblichen politischen Einfluss. Das untergräbt das demokratische Prinzip "eine Person, eine Stimme". Wenn Vermögen politische Entscheidungen prägt, wird Demokratie ausgehöhlt. Es braucht zwei große Reformen. Erstens: eine grundlegende Reform des Steuersystems. Deutschland besteuert Arbeit extrem hoch und Vermögen vergleichsweise gering - kaum ein anderes Land hat eine solch extreme Schieflage im Steuersystem. Das ist mit der Hauptgrund, warum Vermögen so stark wachsen können. Die gegenwärtige Debatte um die Reform der Erbschaftsteuer ist ein Beispiel. Viele der heutigen Milliardäre in Deutschland sind reich geworden, weil sie geerbt haben, oft nahezu steuerfrei. Das Argument, eine stärkere Besteuerung würde Unternehmen zerstören, ist empirisch falsch. Andere Länder zeigen, dass man Unternehmen erhalten und trotzdem Erbschaften fair besteuern kann - indem man Erbschaftsteuern über Jahre und Jahrzehnte stundet, sodass lediglich ein Teil der Gewinne für die Zahlung der Erbschaftsteuer herangezogen wird. Ebenso sinnvoll wäre eine sogenannte Milliardärssteuer nach dem Vorschlag von Gabriel Zucman: zwei Prozent jährlich auf Vermögen über 100 Millionen Euro. Nach Berechnungen meines Kollegen Stefan Bach würde dies knapp 17 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen für den deutschen Staat bedeuten. Selbst dann würden die Vermögen der Hochvermögenden weiter wachsen, denn historisch steigen sie im Schnitt um rund sieben Prozent pro Jahr. Es geht nicht um Enteignung, sondern um eine relativ geringe Beteiligung an den Kosten der Gesellschaft, die diesen Reichtum überhaupt erst möglich macht. Warren Buffett hat es treffend formuliert: Er zahlt einen niedrigeren Steuersatz auf sein Einkommen als seine Sekretärin. Zweitens: echte Chancengleichheit, vor allem in der Bildung. Deutschland schneidet bei der sozialen Mobilität im Bildungssystem erschreckend schlecht ab - schlechter sogar als die USA, obwohl unser Bildungssystem überwiegend öffentlich finanziert ist. Die PISA-Studien zeigen sinkende Leistungen, und das ifo Institut belegt, dass Bildungsungleichheit in den vergangenen Jahrzehnten sogar zugenommen hat. Das ist ein doppeltes Versagen: Wir investieren viel zu wenig in Bildung und erreichen immer weniger - und reproduzieren soziale Unterschiede, statt sie abzubauen. Die Vermögensungleichheit ist heute eine der größten Bedrohungen unserer Demokratie. Wie gefährlich sie geworden ist, zeigt der Einfluss der Tech-Milliardäre in den USA, ohne die Donald Trump und JD Vance kaum an die Macht gekommen wären. Demokratie wird zur Beute des großen Geldes. Deutschland könnte - und sollte - vorangehen. Eine faire Besteuerung großer Erbschaften und Vermögen ließe sich schnell umsetzen. Sie würde der Wirtschaft nicht schaden, sondern sie stärken, weil sie in Bildung, Infrastruktur und soziale Stabilität investiert würde. Am Ende ist es eine Frage des politischen Willens. Wollen wir eine Demokratie, in der jeder Mensch zählt - oder eine Vermögensaristokratie, in der wenige herrschen? Die Antwort darauf entscheidet über unsere Zukunft und die unserer Demokratie.Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1484 21-01-26: Trump, der unbeliebteste Präsident der USA
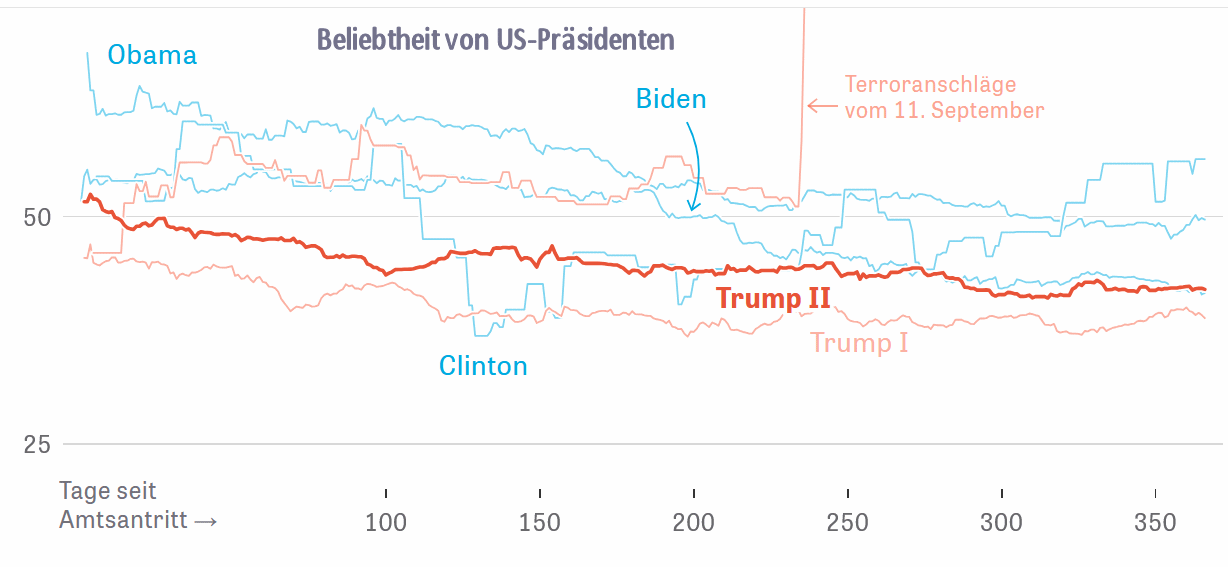
Trump war sowohl in seiner ersten, wie in seiner zweiten Amtszeit der unbeliebteste Präsident, den die USA je hatten (Abb. trump9.gif).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1483 13-01-26: Menschenrechtsorganisation geht von mindestens 2.500 Toten unter den Aufständigen im Iran aus
Die Zahl der getöteten Demonstranten im Iran steigt laut einer NGO auf mindestens 2.500. US-Präsident Trump stellt den Protestierenden dennoch "Hilfe" in Aussicht. Was soll dieses Spiel mit dem Feuer? Bei weiteren Toten wird Trump mit seinen unverantwortlichen Sprüchen mitverantwortlich sein.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1482 30-12-25: Putins Mörderbande
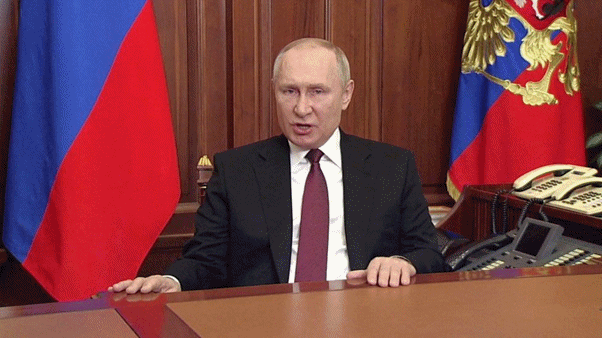
Die Zahl der in der Ukraine von Putins Leuten ermordeten Ukrainer nimmt ständig zu. Dafür hat Putin eine Mörderbande hochrangiger Militärs um sich geschart (Abb.).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1481 21-12-25: Altersarmut: Mehr Rentner auf Grundsicherung angewiesen als je zuvor
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1480 07-12-25: Ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland
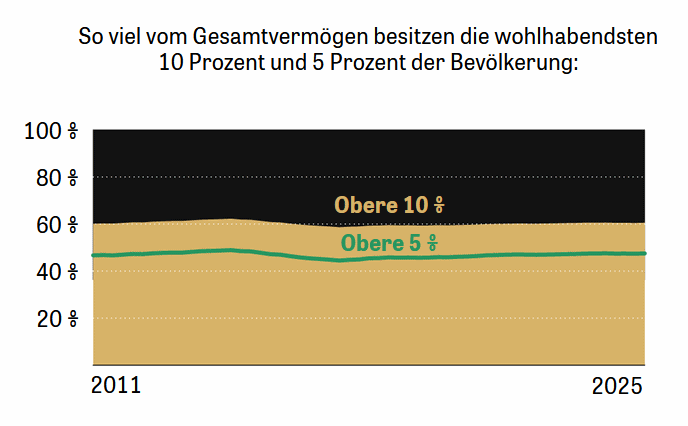
Das Vermögen ist in Deutschland sehr ungleich verteilt. Die oberen 5 % der Bevölkerung besitzen etwa die Hälfte, die oberen 10 % etwa 60 % (Abb. Vermoegen1.gif).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1479 05-12-25: Wir müssen Superreiche endlich stärker besteuern (aus "Die Zeit")
Das reichste Prozent der Welt vermehrt sein Vermögen massiv, während Millionen weiter abrutschen. Das ist ein Risiko für die Demokratie - auch in Deutschland. Ein neuer Oxfam-Bericht versetzt einer ohnehin düsteren Entwicklung den nächsten Schlag: Ein kleiner Kreis Superreicher verzeichnet binnen zwölf Monaten enorme Zugewinne - während Millionen weiter abrutschen.
Inzwischen kontrolliert das reichste Prozent weltweit mehr Vermögen als die gesamte ärmere Hälfte der Bevölkerung. Das ist kein Randphänomen, sondern Ausdruck einer Dynamik, in der Vermögen immer schneller aus sich selbst heraus wächst - und große Teile der Gesellschaft kaum noch Chancen auf eigenen Kapitalaufbau haben. Auch in Deutschland zeigt sich dieses Muster in besonderer Schärfe. Seit vielen Jahren gehört die Bundesrepublik zu den Ländern mit der höchsten Vermögensungleichheit in Europa. Die reichsten zehn Prozent der Haushalte halten zwei Drittel des Nettovermögens; die untere Hälfte der Bevölkerung kommt zusammen gerade einmal auf ein Prozent. Besonders alarmierend: Nahezu dreißig Prozent der Haushalte besitzen keinerlei Vermögen - viele sind sogar überschuldet. Ihnen fehlen nicht nur finanzielle Rücklagen, sondern auch jede reale Chance auf eine stabile wirtschaftliche Perspektive.
Anders als in vielen anderen Industrieländern hängt Vermögen hierzulande stark vom Zufall der Geburt ab, da große Vermögensbestände vor allem über Erbschaften weitergegeben werden. Mehr als die Hälfte des gesamten privaten Vermögens wurde geerbt, nicht selbst erarbeitet. Dies gilt noch stärker für die Hochvermögenden. Die strukturelle Ungleichheit wird dadurch z
ementiert, statt im Laufe einer Lebensarbeitszeit ausgeglichen werden zu können. Die Ursachen liegen in politischem Gestaltungsversagen und verzerrten Anreizen: Kaum ein anderes Land belastet Arbeit so hoch und Vermögen so niedrig wie Deutschland. Kapital und große Vermögen tragen vergleichsweise wenig zum Gemeinwohl bei. Zugleich bleibt der Zugang zu Immobilien - der zentralen Vermögensbasis deutscher Haushalte - für viele unerreichbar.
Zudem fällt die öffentliche Förderung von Vermögensaufbau gering aus und kommt häufig gerade jenen zugute, die ohnehin über hohe Einkommen verfügen. Die Folge ist eine Spaltung, bei der Kapital aus Renditen und Immobilienwertsteigerungen rascher wächst als Arbeitseinkommen, und zwar selbst dann, wenn Menschen hart arbeiten. So sind die Vermögen der Superreichen im vergangenen Jahr um 16,5 Prozent angewachsen, zeigen die Berechnungen von Oxfam - das ist ein vielfach höheres Wachstum als für die meisten Arbeitseinkommen.
Die Folgen reichen weit über individuelle Chancenungleichheiten hinaus. Ökonomisch führt die hohe Konzentration von Vermögen zu einer ineffizienten Nutzung von Kapital. Vermögensarme Haushalte können kaum in Bildung, berufliche Weiterbildung oder selbstständige Tätigkeit investieren. Das hemmt Innovation, Produktivität und die gesamtwirtschaftliche Dynamik. Dabei sind Gesellschaften mit breiter verteiltem Vermögen resilienter, investieren mehr und sie können ihre soziale Marktwirtschaft besser verwirklichen. In Deutschland hingegen führt die Vermögensarmut großer Bevölkerungsteile zu einer chronischen Unterinvestition in menschliches Kapital und privates Eigentum - beides Säulen langfristigen Wachstums.
Doch die wirtschaftlichen Risiken sind nur ein Teil des Problems. Gesellschaftlich befeuert Vermögensungleichheit Polarisierung und Misstrauen. Wer das Gefühl hat, trotz Arbeit nicht voranzukommen, verliert Vertrauen in staatliche Institutionen und demokratische Verfahren. Der Aufschwung populistischer Bewegungen geht in vielen Ländern Hand in Hand mit wachsenden sozialen Ungleichheiten. Extreme Ungleichheit schwächt demokratische Systeme zudem unmittelbar, weil wirtschaftliche Macht politischen Einfluss verstärkt und gesellschaftliche Fairness zunehmend infrage gestellt wird. Wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung weder Vermögen aufbauen noch am Wachstum des wirtschaftlichen Wohlstands teilhaben kann, entsteht ein gefährlicher Nährboden für politische Radikalisierung.
Die Oxfam-Ergebnisse verdeutlichen, dass nur ein entschlossenes politisches Umsteuern Abhilfe schaffen kann. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine grundlegende Neuordnung der Steuerpolitik - national wie global. International bieten die jüngst diskutierten Vorschläge einer Mindestbesteuerung großer Vermögen - etwa das sogenannte Zucman-Modell, also einer globalen Steuer von zwei Prozent pro Jahr auf Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar - einen wichtigen Schritt, um Steuervermeidung durch Vermögensverlagerung einzudämmen. So könnte ein fairerer Beitrag sehr großer Vermögen zur Finanzierung öffentlicher Güter sichergestellt werden. Globale Zusammenarbeit ist unverzichtbar: Kapital ist mobil, und nationale Alleingänge verlieren in der globalisierten Wirtschaft rasch an Wirkung.
Deutschland muss diesen Weg konsequent unterstützen und zugleich sein eigenes Steuersystem modernisieren. Die Besteuerung von Arbeit sollte deutlich reduziert, die Besteuerung großer Vermögen, Kapitalerträge und Erbschaften hingegen angemessen gestärkt werden. Eine gerechte Erfassung großer Immobilienwerte, eine Reform der Erbschaftsteuer und die konsequente Einbeziehung hoher Kapitalgewinne sind zentrale Elemente einer solchen Reform. Dadurch könnten nicht nur staatliche Einnahmen stabilisiert, sondern auch ein fairerer Wettbewerb zwischen Arbeit und Kapital hergestellt werden.
Ebenso wichtig sind konkrete Schritte, die breite Bevölkerungsschichten beim Vermögensaufbau unterstützen. Dazu zählen sichere, kapitalgedeckte Vorsorge, gezielte Hilfen für kleine und mittlere Einkommen beim Ansparen, Investitionen in bezahlbaren Wohnraum sowie ein besserer Zugang zu Bildung und Qualifizierung. Ein inklusiver Arbeitsmarkt, der auch Menschen mit geringeren Startchancen ermöglicht, stabile Erwerbsbiografien aufzubauen, bleibt ein zentraler Baustein jeder vermögenspolitischen Strategie.
Schließlich trägt Deutschland auch international Verantwortung. Eine engagierte Entwicklungszusammenarbeit, faire Handelsbeziehungen und die Stärkung multilateraler Institutionen sind notwendig, um globale Ungleichheit zu reduzieren und Hunger sowie extreme Armut nachhaltig zu bekämpfen. Oxfam weist seit Jahren darauf hin, dass strukturelle Notlagen im Globalen Süden nur durch langfristige Investitionen in Ernährungssicherheit, Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Teilhabe überwunden werden können. Ungleichheit ist keine naturgegebene Tatsache, sondern Ergebnis politischer Entscheidungen. Sie kann daher auch durch politische Entscheidungen überwunden werden.
Die Befunde sind ein Weckruf: Ein System, das Wohlstand bündelt, sägt an seinem eigenen Ast. Gerecht verteilte Chancen und Vermögen sind kein Zierwerk, sondern die Voraussetzung für Stabilität, Stärke - und eine lebendige Demokratie.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1478 05-10-25: 28-Punkte-Entwurf für einen Frieden in der Ukraine - Der Donbass an Russland
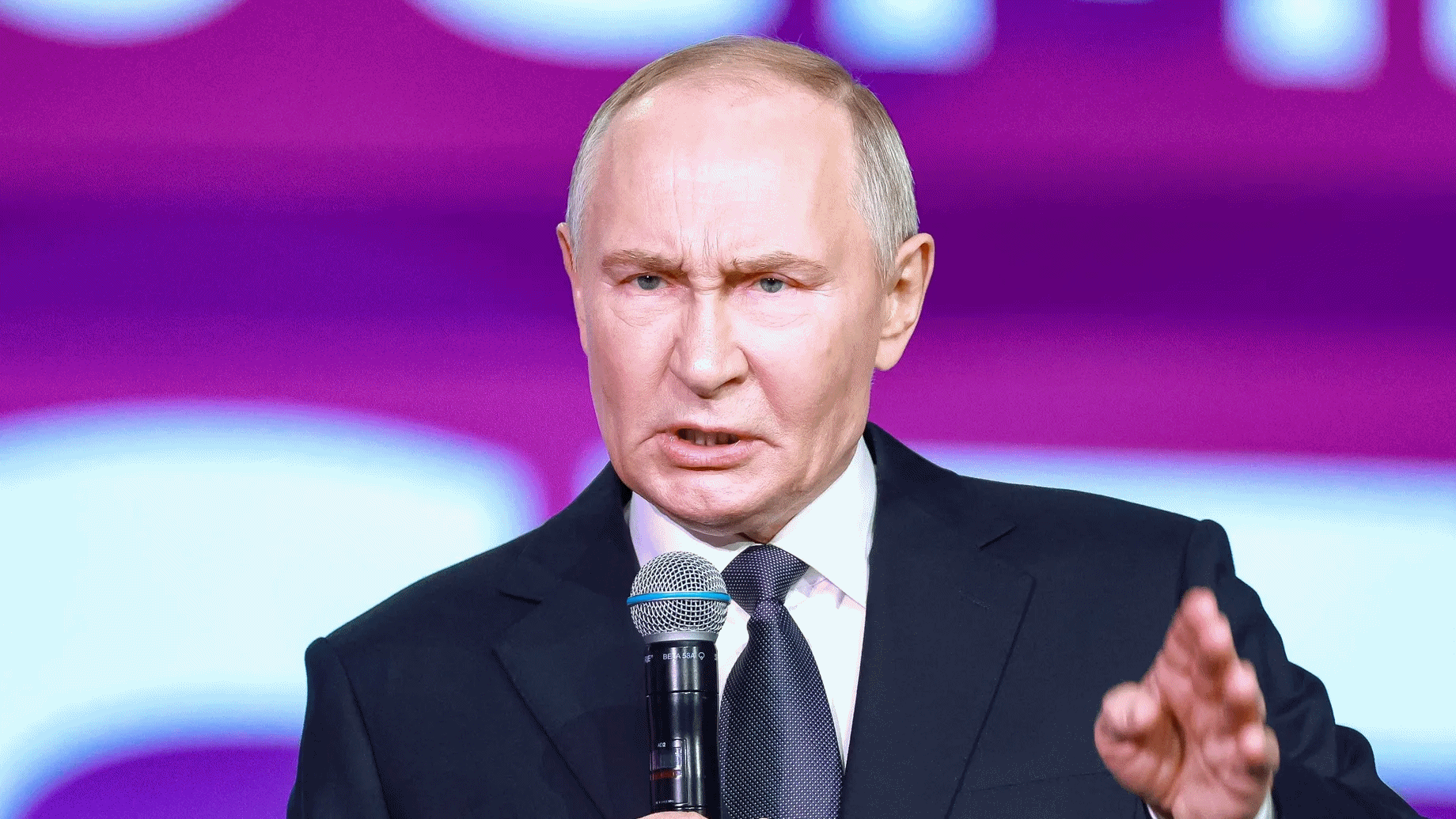
Wenige Tage nach den Ukrainegesprächen in Moskau äußerte sich nun erstmals Russlands Machthaber Wladimir Putin. Das Treffen mit den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner bezeichnete er als "sehr nützlich". Die Gespräche basierten auf den Vorschlägen, die mit US-Präsident Donald Trump in Alaska besprochen worden seien, sagte Putin. Die USA hatten im November einen 28-Punkte-Entwurf für einen Frieden vorgelegt. Darin sollte die Ukraine große Zugeständnisse an Russland machen, wie die Abtretung von ukrainischem Staatsgebiet und die Verkleinerung der Armee. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump versucht erneut, mit Moskau und Kyjiw über Wege zu einer Waffenruhe zu verhandeln - bisher ohne Erfolg.
Nach eigenen Angaben hat Putin vorgeschlagen, dass die Ukraine ihre Truppen aus dem Donbass abzieht und keine militärischen Aktionen startet. Doch Kyjiw ziehe es vor, zu kämpfen, sagte der Kremlchef. Russland habe, so stellt es Putin dar, den Friedensvorschlägen der USA nicht zugestimmt. Es sei eine schwierige Arbeit, sagte der russische Machthaber. Das Treffen mit der Delegation aus Washington hat ihm zufolge "fünf Stunden" gedauert. Es habe so lange gedauert, weil fast jeder Punkt des US-amerikanischen Entwurfs durchgesprochen worden sei.
Russlands Machthaber gibt auch Einblicke in mögliche nächste Schritte für Verhandlungen. Die USA hätten vorgeschlagen, die 28 Punkte des Friedensplans in "vier Pakete" aufzuteilen und diese zu diskutieren. Putin gab sich erneut siegesgewiss: Russland werde den Donbass und "Neurussland" - auf jeden Fall "befreien" - mit militärischen oder anderen Mitteln, betonte Putin. Mit "Neurussland" bezeichnet er das Gebiet, das neben Donezk und Luhansk auch Saporischschja und Cherson im Süden einschließt. Putin hatte diese, obwohl seine Truppen sie nicht vollständig kontrollieren, am 30. September 2022 der Russischen Föderation per Verfassung einverleibt. Mit seiner Aussage machte Putin einmal mehr seine imperialistischen Ziele deutlich. Seine Abkehr vom Westen betonte er dadurch, dass er erklärte, Russland habe nicht vor, in die G8 zurückzukehren.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1477 27-11-25: Das Gesicht eines Massenmörders
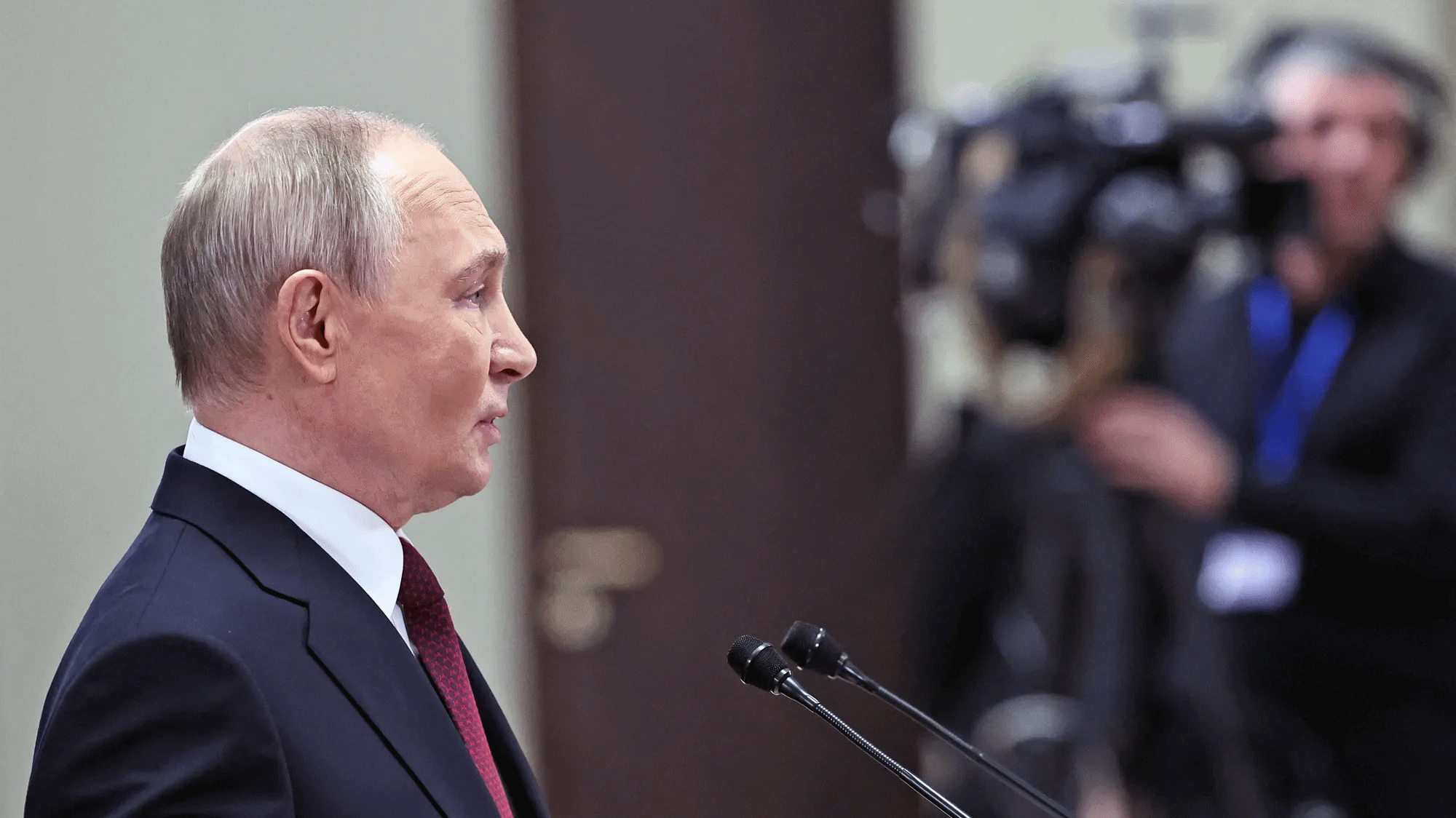
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1476 27-11-25: Israels Militär ist immer wieder gut fürs Morden Unschuldiger
Im Westjordanland sollen zwei Männer erschossen worden sein, nachdem sie sich ergeben haben. Das berichten israelische und palästinensische Medien. Das israelische Militär kündigte eine Untersuchung an. Israelische Sicherheitskräfte haben im Westjordanland zwei Palästinenser getötet, die sich laut Berichten zuvor ergeben haben sollen. Die beiden Palästinenser seien aus nächster Nähe erschossen worden, meldeten mehrere israelische und palästinensische Medien, darunter auch die "Jerusalem Post". Ein von einem ägyptischen Sender verbreitetes Video soll den Vorfall in der Nähe der Stadt Dschenin zeigen.
Israels Armee und Polizei kündigten an, den Vorfall zu untersuchen. Die Einsatzkräfte hätten ein Gebäude umstellt, in dem sich von Israel gesuchte Verdächtige befanden. Nach mehreren Stunden hätten die Militanten das Gebäude verlassen, danach sei auf sie geschossen worden. Wer die Schüsse abgab, sagte die israelische Armee nicht. Sie machte auch keine Angaben, ob sich die Palästinenser vorher ergeben haben. Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah teilte mit, Israels Armee habe die Behörde über den Tod der beiden Palästinenser informiert. Demnach waren sie 26 und 37 Jahre alt. "Der Vorfall wird von den Kommandeuren vor Ort untersucht und wird an die zuständigen Fachstellen weitergeleitet", schreiben Militär und die Polizei in einer Mitteilung.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1475 27-11-25: Der Anteil älterer Frauen mit weniger als 50 % des Durchschnitts der Haushaltseinkommen ist mit 15 % relativ hoch
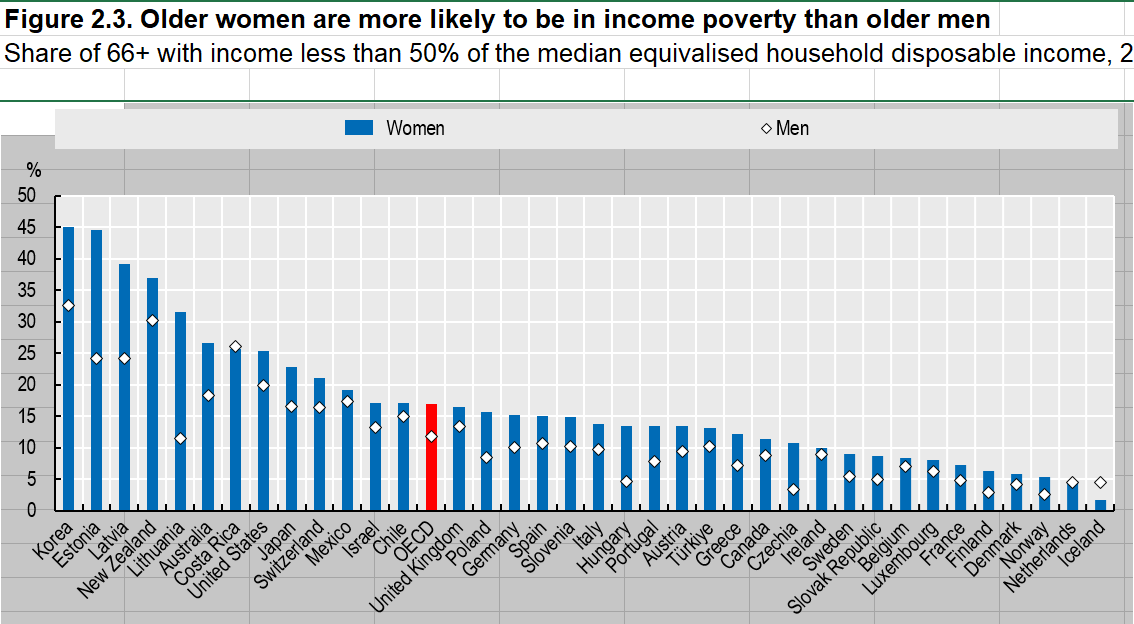
Der Anteil älterer Frauen mit weniger als 50 % des Durchschnitts der Haushaltseinkommen ist mit 15 % relativ hoch und weit höher als z.B. in den Niederlanden, Norwegen, Finnland und Frankreich (Abb.).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1474 24-11-25: Öffentliche Ausgaben im internationalen Vergleich
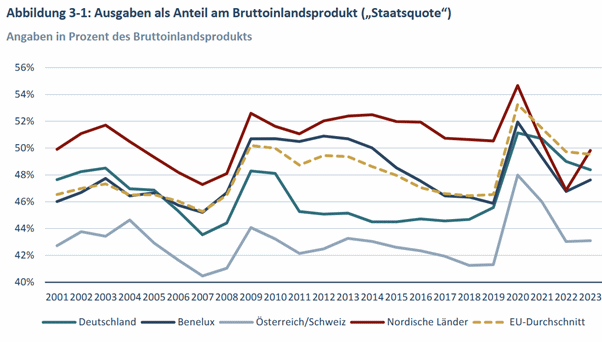
Öffentliche Ausgaben im internationalen Vergleich: Höhe der gesamten Ausgaben Abbildung 30229 (3-1)zeigt, wie sich die gesamten Ausgaben in Deutschland und den betrachteten Vergleichsgruppen relativ zur Wirtschaftsleistung entwickelt haben ("Staatsquote"). Zunächst fällt die Korrelation zwischen den Entwicklungen auf. Im Zuge der Finanzkrise stiegen die Staatsquoten im Jahr 2009 deutlich an, normalisierten sich anschließend sukzessive wieder, ehe sie im Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie wieder anstiegen. Die Werte für Deutschland liegen dabei recht nahe am EU-Durchschnitt. Bis ins Jahr 2005 befand sich Deutschland noch leicht über dem EU-Durchschnitt, seit 2006 darunter. In den 2010er Jahren lag der deutsche Wert zumeist bei etwa 45 Prozent und somit bis zu 4,4 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt. Seit der Corona-Pandemie liegen die Werte in etwa gleichauf bei zuletzt knapp 50 Prozent.
Den höchsten Wert wies in den meisten Jahren die nordische Ländergruppe auf, wo die Staatsquote in der Corona-Pandemie gar auf 55 Prozent anstieg. Nur in den Jahren 2021 und 2022 lagen die Werte unterhalb des EU-Durchschnitts. Die nordischen Länder sind die einzige Ländergruppe, deren Staatsquote im Jahr 2023 unterhalb des Vor-Corona-Niveaus lag. Zum Vergleich: in Deutschland lag der Wert zuletzt 2,8 Prozentpunkte über dem Vor-Corona-Niveau. Während die Benelux-Staaten weitgehend dem EU-Durchschnitt folgen, liegen die Werte in der Ländergruppe Österreich/Schweiz deutlich niedriger. Sie befinden sich im gesamten Be- obachtungszeitraum etwa 5 Prozentpunkte unter dem EU-Durchschnitt, am aktuellen Rand liegt der Wert bei 43 Prozent. Der EU-Durchschnitt lag zuletzt höher als die Werte in den meisten Vergleichsgruppen. Dies ist den hohen Staatsquoten etwa in Frankreich und Italien geschuldet.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1473 23-11-25: Jedes siebte Kind in Deutschland galt im vergangenen Jahr als armutsgefährdet
Die Daten des Statistischen Bundesamts sind alarmierend. Jedes siebte Kind in Deutschland galt im vergangenen Jahr als armutsgefährdet - die Zahlen haben sich gegenüber dem Vorjahr sogar verschlechtert. Der Gründer des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland nun Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen.
Als 2001 der Armuts- und Reichtumsbericht eingeführt worden sei, habe er noch gedacht, dass "endlich" etwas gegen Kinderarmut getan werde, sagte Siggelkow dem Sender ntv laut Meldung vom Sonntag. Verbesserungen seien seitdem aber nicht zu erkennen - im Gegenteil: "Inzwischen haben sich die Armutszahlen verdreifacht, obwohl die Geburten zurückgehen."
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1472 21-11-25: Die deutsche Dauerkrise
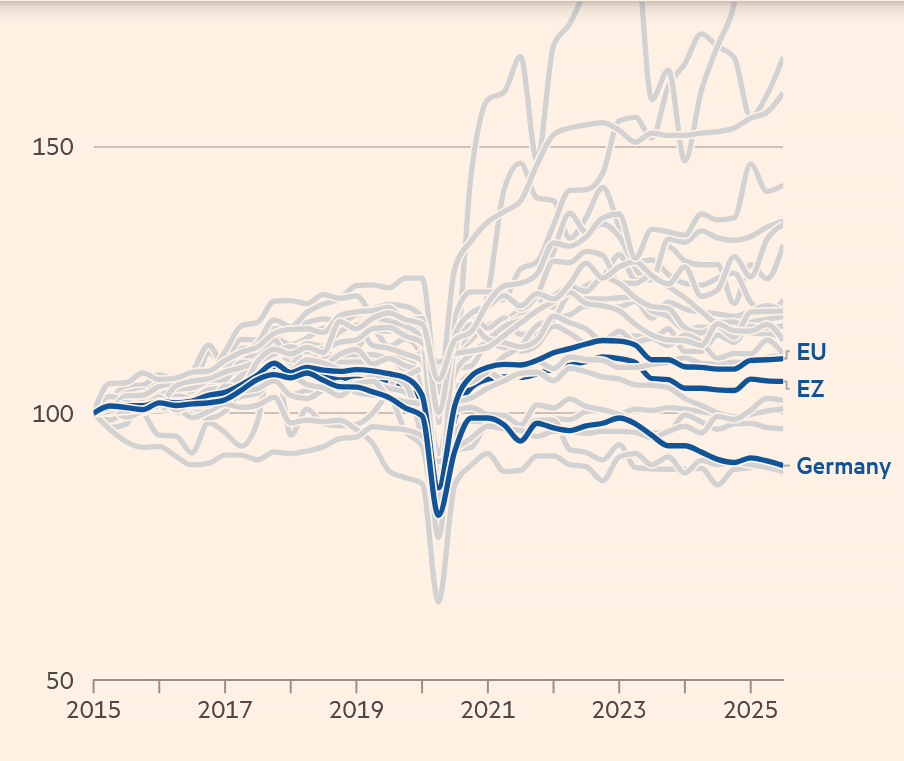

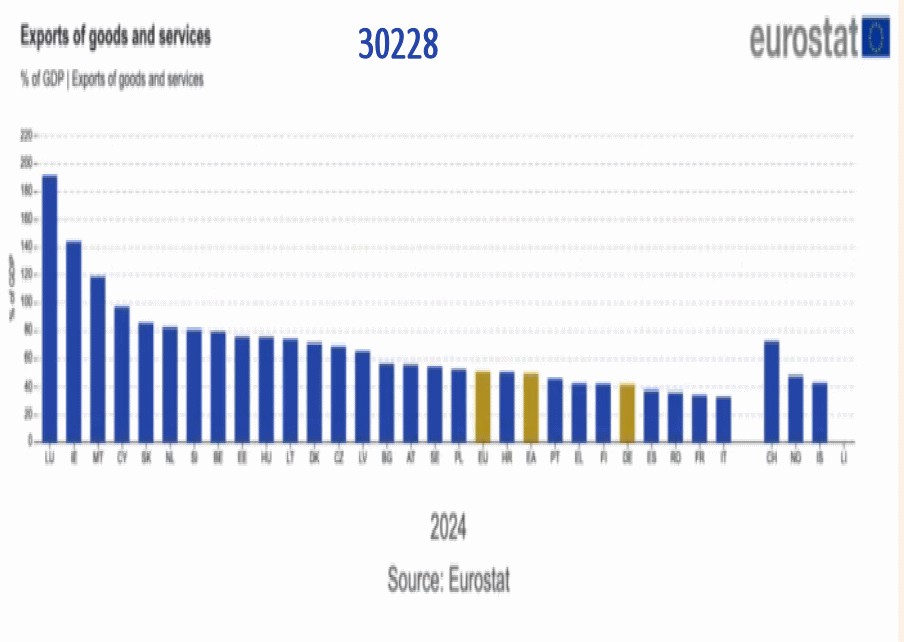
Die deutsche Wirtschaftsleistung ist seit Jahren eine der schwächsten in der EU (Abb. 30222, 30214).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1471 19-11-25: Die reichsten 10 Prozent sind für fast die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich
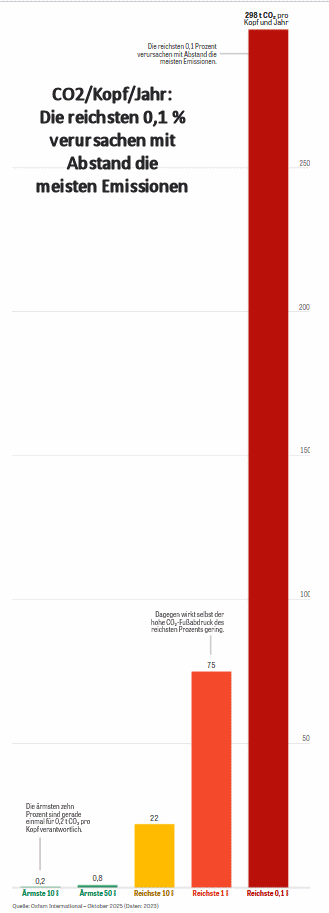
Privatjets, Megajachten, transkontinentale Wochenendtrips - kaum etwas macht die ökologische Schieflage unserer Gegenwart so greifbar wie der CO2-Ausstoß extrem reicher Menschen. Ein besonders sichtbares Beispiel ist Taylor Swift. Die Sängerin stieß allein während ihrer Reisen zu den Football-Spielen ihres mittlerweile Verlobten im Herbst 2023 rund 138 Tonnen CO2 in drei Monaten aus - das ist mehr als eine einzelne Person in vielen Industrieländern im Schnitt in einem gesamten Jahrzehnt verursacht. Swift weist zwar darauf hin, dass sie doppelt so viele CO2-Zertifikate kaufe, wie sie bräuchte, um ihre Flüge zu kompensieren; Experten betonen jedoch, dass private Jets pro Kopf mindestens zehnmal klimaschädlicher sind als Linienflüge.
Noch drastischer wird die Dimension des Überkonsums auf dem Wasser. Die neuen Megajachten - schwimmende Stahlpaläste ab 70 Metern Länge - gelten nicht nur als die teuersten beweglichen Güter der Welt, sondern auch als die emissionsintensivsten Besitztümer, die man kaufen kann. Die beiden Jachten des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch beispielsweise stoßen Schätzungen zufolge mehr als 22.000 Tonnen CO2 pro Jahr aus - das entspricht in etwa der Bilanz von Kleinstaaten. Ein Großteil dieser Emissionen entsteht dabei nicht einmal während der Fahrt, sondern allein durch den Betrieb der Schiffe: Strom, Kühlung, Sicherheitssysteme, Besatzung.
Diese Beispiele sind keine Anekdoten, sie markieren strukturelle Extreme. Und zeigen, wie klein die Gruppe ist, die für einen gewaltigen Teil der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist - und wie groß der Abstand zwischen individuellem Lebensstil und kollektiver Klimapolitik geworden ist.
Während einzelne Promis die Debatte sichtbar machen, zeigen die Daten etwas Grundsätzlicheres: Seit dem Pariser Klimaabkommen 2015 hat das reichste Prozent der Weltbevölkerung mehr als doppelt so viel CO2 verursacht wie die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Noch extremer sind die Emissionen des obersten Promille - einer globalen Gruppe von geschätzt etwa acht Millionen Menschen: Sie verursachen durch ihren Konsum fast genauso viele Emissionen wie die rund vier Milliarden Menschen, die die ärmsten 50 Prozent der Menschheit ausmachen.
Diese Daten gehen aus einer Analyse von Oxfam International hervor, die vor Kurzem unter dem Titel Climate Plunder veröffentlicht wurde. "Wir sehen sehr deutlich, dass die Emissionen mit wachsendem Einkommen stark steigen: größere Häuser, mehrere Autos, viel mehr Reisen und generell viel mehr Konsum", sagt Manuel Schmitt, Referent für soziale Ungleichheit bei Oxfam Deutschland. Seit 1990 haben sich diese Unterschiede nicht nur verfestigt, sondern noch verschärft. Während die reichsten Menschen ihren Pro-Kopf-Ausstoß weiter steigerten - unter den obersten 0,1 Prozent um 45 Prozent -, blieb die Veränderung bei Menschen in unteren Einkommensgruppen minimal oder fiel sogar negativ aus. Das zeigt, wie eng Klimapolitik und wirtschaftliche Ungleichheit ineinandergreifen: Während der globale Ausstoß insgesamt gestiegen ist, hat sich die Verteilung der Emissionen deutlich zugunsten der Wohlhabendsten verschoben.
Der Fußabdruck der Wohlhabendsten wächst
Die Analyse von Oxfam arbeitet mit konsum- oder verbrauchsbezogenen Emissionen (consumption-based emissions). Gemeint sind alle Treibhausgase, die durch den persönlichen Lebensstil einer Person entstehen - also durch Wohnen, Heizen, Strom, Mobilität, Ernährung, Konsumgüter und vor allem Flugreisen. Wichtig dabei: Berücksichtigt werden auch Emissionen, die entlang globaler Lieferketten entstehen. Wer ein importiertes Produkt kauft, dessen CO2-Ausstoß wird der konsumierenden Person zugerechnet, nicht dem Produktionsland.
Superreiche Menschen haben aber oft nicht nur privat einen besonders hohen CO2-Fußabdruck. Viele von ihnen halten außerdem Anteile an Unternehmen, die ebenfalls erheblichen Einfluss auf das globale Emissionsgeschehen haben. Oxfam hat dafür das Portfolio von 308 Milliardären untersucht. Sie sind zusammen für 586 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr verantwortlich - die gleiche Menge, wie sie mehr als 118 Länder zusammen im gleichen Zeitraum ausstoßen. Würde man die Reichsten der Reichen als einen Staat betrachten, lägen sie auf Platz 15 der größten Emittenten weltweit, noch vor Südafrika. Fast 60 Prozent ihres Vermögens sind in besonders klimaschädliche Branchen investiert. Für Schmitt ist klar: "Wer über solche Vermögen verfügt, hat auch eine strukturell viel größere Verantwortung."
Die reichsten Deutschen stoßen 50-mal so viel CO2 aus wie die ärmsten
Auch in Deutschland zeigt sich die Klimakrise als Verteilungsfrage. Das einkommensstärkste Zehntel der Bevölkerung verursacht laut Oxfam rund 28 Prozent der deutschen CO2-Emissionen, fast genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte zusammen. Besonders extrem ist auch hier das oberste Promille. Eine Person aus den reichsten 0,1 Prozent stößt im Schnitt über 840 Kilogramm CO2 pro Tag aus - ein Wert, der keinen gerechten Beitrag zu den Klimazielen für Deutschland und Europa beisteuern kann. Die unteren 50 Prozent liegen dagegen bei etwa 16 Kilogramm, die ärmsten zehn Prozent sogar nur bei rund 11 Kilogramm CO2 pro Tag.
Während die reichsten Menschen prinzipiell die größten Einsparmöglichkeiten haben, was ihren Fußabdruck angeht, können viele Menschen mit niedrigem Einkommen ihre Emissionen kaum weiter senken. "Menschen aus ärmeren Bevölkerungsgruppen stecken oft in klimaschädlichen Strukturen fest", erklärt Schmitt. Wer zur Miete wohnt, könne selten beeinflussen, ob eine Wohnung mit erneuerbaren Energien beheizt wird; in vielen Regionen gebe es zudem kaum Alternativen zum Auto.
Insgesamt sind die Emissionen Deutschlands seit den 1990er-Jahren aber deutlich gesunken. Doch auch hierbei tragen gerade Menschen mit niedrigen Einkommen besonders stark dazu bei: Seit 1990 sanken die Emissionen der ärmeren 50 Prozent der Bevölkerung im Schnitt um 36 Prozent, während die Werte des reichsten Prozents nur um 25 Prozent sanken - trotz deutlich größerer finanzieller Möglichkeiten, klimafreundlicher zu leben.
Im internationalen Vergleich gehören allerdings weite Teile der deutschen Bevölkerung zu den wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen. Schätzungen zufolge zählt etwas mehr als die Hälfte der Deutschen zu den reichsten zehn Prozent der Welt. Auch wenn Deutschland intern große Emissionsunterschiede aufweist, sind selbst die mittleren und ärmeren Bevölkerungsgruppen im globalen Vergleich eher wohlhabend - und leben damit vergleichsweise klimaschädlich. Der konsumbezogene CO2-Fußabdruck eines durchschnittlichen Deutschen liegt übrigens bei rund 11 Tonnen pro Kopf im Jahr. Zum Vergleich: Im weltweiten Durchschnitt sind es etwa 5,1 Tonnen - der deutsche Wert liegt damit mehr als doppelt so hoch.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1470 18-11-25: Schlechte Aussichten: Immer mehr Rentner pro Erwerbstaetige
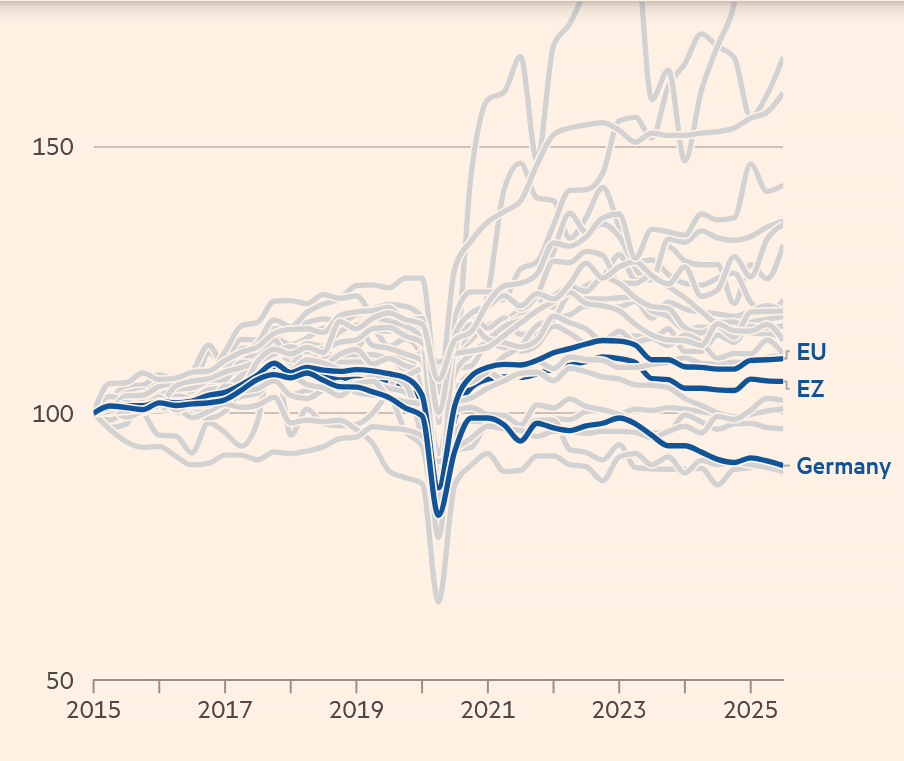
In der alternden Gesellschaft müssen künftig weniger Beitragszahler immer mehr Rentenempfänger finanzieren (Abb. Rentner-Erwerbstätige). Damit die Rentenkasse nicht in Schieflage gerät, enthält die Rentenformel einen sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Er sorgt dafür, dass das Rentenniveau nach und nach sinkt. Nach Prognosen der Regierung liegt es 2029 bei 47,3 und 2040 nur noch bei 45 Prozent des Lohns. Die SPD hatte sich deshalb im Wahlkampf dafür ausgesprochen, dieses Niveau bis 2039 bei 48 Prozent festzuzurren.
Das für diese Haltelinie benötigte Geld müssen aber nicht die Beitragszahler aufbringen, es würde aus dem Bundeshaushalt an die Rentenkasse überwiesen. Der Union ging das zu weit. Man einigte sich also auf eine Stabilisierung bis zum Jahr 2031. Im Koalitionsvertrag steht, man werde "das Rentenniveau bei 48 Prozent gesetzlich bis zum Jahr 2031 absichern" und die Mehrausgaben "mit Steuermitteln" ausgleichen.
Das bedeutet: Bis 2031 verbleibt das Rentenniveau bei 48 Prozent des Durchschnittseinkommens - was das für die einzelnen Rentner und Rentnerinnen in Euro und Cent bedeutet, hängt vom individuellen Verdienst und der Zahl der Beitragsjahre ab. In Regierungskreisen hat man aber eine erste Prognose für das Jahr 2031 gemacht und schätzt, dass dann eine monatliche Rente von 1.500 Euro rund 33 Euro höher ausfällt, wenn sich die Regierungspläne durchsetzen.
Interessant und politisch umstritten ist, wie es danach weitergeht. Der Gesetzentwurf von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) sieht vor, dass ab 2031 die Haltelinie entfällt. Das Rentenniveau würde wieder alleine durch die Rentenformel - die sich unter anderem am Verhältnis der Rentenbezieher zu den Beitragszahlern orientiert - bestimmt werden. Es läge dann im Jahr 2035 bei 46,7 und im Jahr 2040 bei nur noch 46,0 Prozent.
Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion argumentiert nun, dass die Regierung damit über den Koalitionsvertrag hinausgehe. Zwar würde das Rentenniveau nach 2031 sinken, aber eben ausgehend von dem durch die eingezogene Haltelinie erhöhten Niveau. So blieben die Renten dauerhaft höher als ohne Haltelinie. Die Junge Gruppe will dagegen ab 2032 die Rentenformel auf das Niveau anwenden, das sich ohne staatliche Eingriffe ergeben hätte.
Laut Berechnungen des Unternehmens Prognos für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) macht der Unterschied bis 2040 etwa 142 Milliarden Euro aus, bis 2050 sogar 380 Milliarden Euro. Dieses Geld müssten die Steuerzahler zusätzlich aufbringen. Die INSM ist eine Lobbyorganisation der Arbeitgeberverbände. Dazu kommen 100 Milliarden Euro für die von der CSU durchgesetzte Ausweitung der Mütterrente.
Wichtig ist, und das geht in der politischen Debatte oft verloren: Die Absenkung des Rentenniveaus bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Renten sinken. Das Rentenniveau ist eine relative Größe, es beschreibt das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn. Wenn die Löhne also stark genug steigen, dann bekommen die Rentner selbst bei einem sinkenden Rentenniveau mehr Geld.
Wenn das Rentenniveau mit dem Auslaufen der Haltelinie jedoch zurück auf das ursprünglich vorgesehene Niveau zurückfallen sollte (was die jungen Unionsabgeordneten fordern), könnten die Renten tatsächlich sinken. Das Forschungsinstitut Prognos hat den Vorschlag durchgerechnet und kommt auf ein Minus von 0,7 Prozent. Rentenkürzungen sind allerdings gesetzlich verboten. "Sinkende Renten wollen wir nicht", sagt Pascal Reddig, Vorsitzender der Jungen Gruppe in der Unionsfraktion, im Gespräch mit der ZEIT: "Es gibt mehrere Möglichkeiten, auch in Zukunft Rentenerhöhungen sicherzustellen und die Folgekosten des Gesetzentwurfs deutlich zu reduzieren."
Eine Möglichkeit wäre es, die Anpassung auf zwei Jahre zu verteilen. Oder so lange Nullrunden ohne Rentenerhöhung zu verordnen, bis das gewünschte Niveau erreicht ist. Der eingesparte Betrag würde sich so allerdings etwas verringern.
Gesetze werden in einer Regierung abgestimmt, bevor sie in den Bundestag eingebracht werden. Das ist auch in diesem Fall geschehen. Dabei hatte die Union nach Angaben aus Teilnehmerkreisen keine Einwände gegen den Entwurf des Arbeitsministeriums, dem alle Kabinettsmitglieder (also auch die der Union) zustimmten. Das liegt womöglich auch daran, dass die Mechanik des aktuellen Gesetzes exakt dieselbe ist wie bei der letzten Einführung einer Haltelinie unter Angela Merkel im Jahr 2018. Auch damals wurde - wie heute - das erhöhte Niveau nach Auslaufen der Stabilisierungsmaßnahmen nicht gesenkt. Aus dieser Perspektive geht der Gesetzentwurf also nicht über den Koalitionsvertrag hinaus.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1469 17-11-25: Jede siebte Person unter 18 Jahren armutsgefährdet
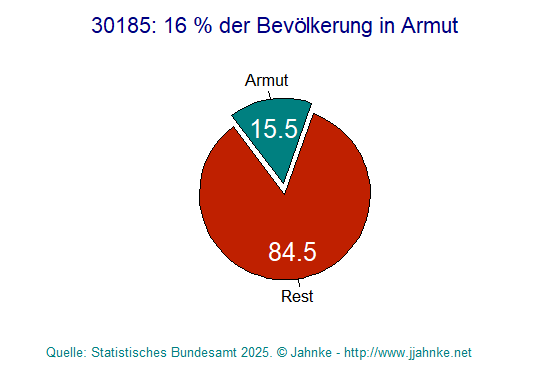
15,2 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland waren 2024 armutsgefährdet. Damit war gut jede siebte Person unter 18 Jahren betroffen. Das entspricht gut 2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen lag damit leicht unter der der Gesamtbevölkerung (15,5 %). Ähnlich wie letztere ist auch die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen zuletzt gestiegen: 2023 hatte sie bei 14,0 % gelegen (Bevölkerung insgesamt 14,4 %). Eine Person gilt als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60 % des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1468 14-11-25: Wachsende Überschuldung in Deutschland
Die Konjunkturflaute sorgt für wachsende Überschuldung in Deutschland. 2025 sind 5,67 Millionen Menschen über 18 Jahre überschuldet und damit 111.000 oder zwei Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditreform zur Veröffentlichung ihres Schuldneratlas' Deutschland am Freitag mitteilte. "Nach sechs Jahren rückläufiger Zahlen kehrt die Überschuldung in Deutschland zurück." Die Überschuldungsquote steigt demnach auf 8,16 (2024: 8,09 Prozent). Damit verzeichne Deutschland erstmals seit 2018 wieder einen spürbaren Anstieg.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1467 14-11-25: Reform der Erbschaftsteuer: Wir brauchen keine neue Erbschaftsteuer, sondern eine ehrliche
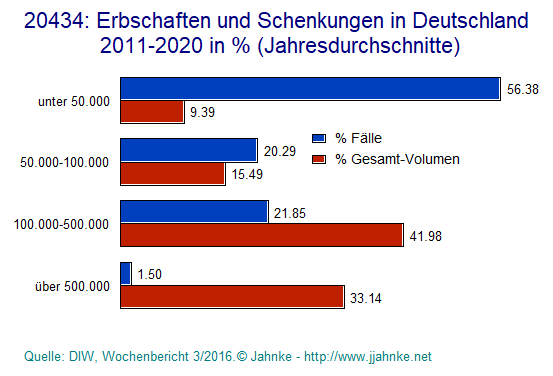
Milliardenerbschaften bleiben oft steuerfrei. Die Debatte über die Erbschaftsteuer flammt alle paar Jahre wieder auf - meist wenn das Bundesverfassungsgericht droht, das nächste Loch in das ohnehin löchrige Regelwerk zu reißen. Schnell fordern manche eine grundlegende Reform, andere eine Abschaffung der Steuer und wieder andere eine Erhöhung der Sätze. Wer genauer hinschaut, erkennt: Eine Revolution braucht es nicht: Das deutsche Erbschaftsteuerrecht funktioniert im Kern. Korrigiert werden muss dort, wo es sich zugunsten weniger sehr Reicher verbogen hat.
Während Normalbürger für die geerbte Eigentumswohnung in München oder das Elternhaus im Speckgürtel längst Erbschaftsteuer zahlen, bleiben Milliardenerbschaften in Unternehmensanteilen oder über komplizierte Familienstiftungen oft vollständig steuerfrei. Das ist nicht nur ungerecht, sondern ökonomisch ineffizient. Es verzerrt die Vermögensverteilung und untergräbt die Akzeptanz einer Steuer, die eigentlich die Chancengleichheit stärken soll.
Das Prinzip ist richtig: Besteuert wird nicht Leistung, sondern Zufall. Niemand sucht sich seine Eltern aus, niemand erarbeitet sich seine Erbschaft. Wenn aber ein Prozent der Haushalte fast ein Drittel des gesamten Vermögens hält und jährlich dreistellige Milliardenbeträge vererbt oder verschenkt werden, dann entscheidet Erben oft mehr über Lebenswege als Bildung oder Fleiß. Denn mehr als die Hälfte aller privaten Vermögen (PDF) in Deutschland heute wurde geerbt und nicht selbst erarbeitet.
Laut Erhebungen am DIW Berlin werden in Deutschland jährlich Vermögen von rund 300 bis 400 Milliarden Euro übertragen. Doch nur ein gutes Viertel davon taucht überhaupt in der Steuerstatistik auf. Der Rest bleibt steuerfrei - meist wegen hoher Freibeträge oder großzügiger Ausnahmen. So beträgt der Freibetrag für Kinder 400.000 Euro, für Ehepartner 500.000 Euro. Und wer clever genug ist, kann Vermögen über Jahrzehnte verteilt immer wieder steuerfrei verschenken.
Noch gravierender sind die Ausnahmen für Unternehmensvermögen. Wer ein Familienunternehmen erbt, kann 85 oder sogar 100 Prozent des Wertes steuerfrei erhalten - unter Bedingungen, die in der Praxis leicht zu erfüllen sind. Solche begünstigten Unternehmensübertragungen machen rund 30 Milliarden Euro pro Jahr aus. Dem Staat entgehen Milliarden, während die Vermögenskonzentration zunimmt.
Die jüngste DIW-Simulationsstudie zeigt, wie stark diese Begünstigungen wirken. Würde man allein die Steuervergünstigungen für Unternehmen und vermietete Immobilien streichen, würde das Steueraufkommen um rund 7,8 Milliarden Euro oder 65 Prozent steigen. Fast 80 Prozent dieser Mehreinnahmen kämen von Übertragungen ab fünf Millionen Euro - also von den wirklich großen Erbschaften. Die Zahl der Steuerpflichtigen würde nur um gut vier Prozent steigen. Das widerlegt die Erzählung, die Erbschaftsteuer erdrücke den Mittelstand. Fakt ist: Nur etwa elf Prozent aller Erbenden zahlen überhaupt Erbschaftsteuer. Die Mehrheit der Bevölkerung erbt wenig oder gar nichts, und selbst mittlere Erbschaften bleiben meist unter den Freibeträgen. Das ist sozialpolitisch akzeptabel - aber nur, wenn die obersten Vermögensgruppen tatsächlich ihren Anteil leisten. Heute ist das Gegenteil der Fall: je reicher die Erbschaft, desto geringer der effektive Steuersatz. Ab etwa 300 Millionen Euro wird fast gar keine Steuer mehr fällig, weil das Vermögen fast vollständig als Betriebsvermögen gilt. Das ist regressiv und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz.
So entsteht eine Erbengesellschaft, in der sich Vermögen über Generationen verfestigt. Wer in Deutschland geboren wird, hat nach Berechnungen des DIW Berlin heute eine etwa 50-fach höhere Chance auf ein Millionenvermögen, wenn die Eltern wohlhabend sind. Die Erbschaftsteuer könnte diesen Trend dämpfen - wenn sie nicht durch Ausnahmen ausgehöhlt wäre.
Sinnvoll ist ein zweiter Schritt bei den Schenkungen: Heute kann derselbe Begünstigte alle zehn Jahre erneut steuerfrei beschenkt werden. Das begünstigt vor allem sehr Vermögende, die ihr Geld schon zu Lebzeiten portionsweise übertragen. Klug wäre, Freibeträge über die gesamte Lebenszeit einer Person zu kumulieren. Das vereinfacht die Steuer, verhindert Missbrauch und entlastet normale Erbfälle.
Ein einheitlicher Lebensfreibetrag von einer Million Euro - wie in den DIW-Simulationen getestet - würde die Zahl der Steuerzahlenden um 90 Prozent senken, ohne die Einnahmen nennenswert zu verringern. Denn die Mehreinnahmen stammen ohnehin fast ausschließlich von großen Unternehmensübertragungen.
Die Lehre ist klar: Wir brauchen keine neue Erbschaftsteuer, sondern eine ehrliche. Keine großen Systembrüche - sondern die Abschaffung der Ausnahmen für sehr große Erbschaften, insbesondere bei Unternehmen. Zugleich sollten Stundungsregeln gesetzlich festgeschrieben werden, damit Steuerzahlungen über viele Jahre gestreckt werden können. Damit ließe sich der Konflikt zwischen Gerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit lösen.
Das heutige System benachteiligt sogar kleine und mittlere Firmen indirekt, weil es große Vermögen überproportional entlastet. Eine vereinfachte, transparente und verfassungsfeste Erbschaftsteuer stärkt den Mittelstand, statt ihn zu gefährden. Oft heißt es, eine höhere Erbschaftsteuer schade der Wirtschaft. Das Gegenteil ist plausibel: Wer geerbten Reichtum moderat besteuert, stärkt Chancengleichheit, lenkt Kapital in produktive Investitionen und erhöht die Akzeptanz eines Systems, das Leistung belohnen soll.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1466 12-11-25: Wirtschaftsweise sehen auch 2026 keinen spürbaren Aufschwung
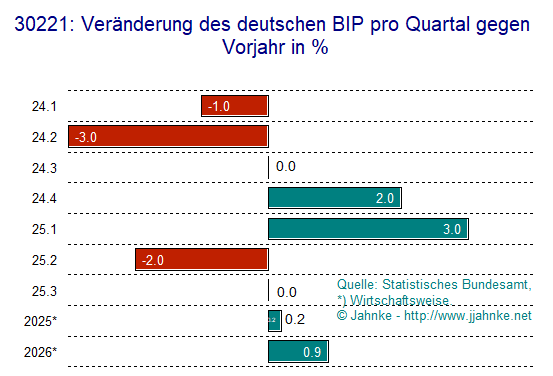
Die deutsche Wirtschaft schwächelt weiter. Das Expertengremium der Wirtschaftsweisen rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent (Abb. 30221). Auch im kommenden Jahr erwarten die Wirtschaftsweisen keinen breit angelegten Aufschwung in Deutschland. Der Sachverständigenrat korrigierte seine Erwartungen für 2026 leicht nach unten und rechnet nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,9 Prozent.
Im Frühjahr hatten die Ökonomen für 2026 ein Plus von 1,0 Prozent erwartet. Die Bundesregierung rechnet im kommenden Jahr mit einem Wachstum von 1,3 Prozent. Der Sachverständigenrat geht in seinem aktuellen Jahresgutachten davon aus, dass die aktuell geplanten Ausgaben des Milliardensondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität nur eine geringe positive Wirkung auf das Bruttoinlandsprodukt haben. Das liege daran, dass es bisher größtenteils für Umschichtungen im Haushalt und zur Finanzierung konsumtiver Ausgaben genutzt werde - wie für die Ausweitung der Mütterrente.
Für das laufende Jahr erhöhten sie ihre Wachstumsprognose leicht auf ein Plus von 0,2 Prozent. Im Frühjahr hatte der Rat eine Stagnation erwartet. Deutschland steckt seit Jahren in einer Schwächephase. Wirtschaftsverbände sehen viele strukturelle Probleme wie im internationalen Vergleich hohe Energiepreise, steigende Sozialabgaben und zu viel Bürokratie.
Die Wirtschaftsweisen sprechen sich in ihrem Jahresgutachten zudem dafür aus, die Erbschafts- und Schenkungssteuer zu reformieren. Ziel ist dabei eine gleichmäßigere Besteuerung aller Vermögensarten. Allerdings lehnt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Reform ab.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1465 12-11-25: Jedes siebte Kind in Deutschland in Armut
Rund 14 Prozent der unter 18-Jährigen lebten 2023 in Haushalten mit einem Armutsrisiko - jedes siebte Kind in Deutschland. Dabei zeigt sich für rund 1, 3 Millionen Heranwachsende die Armut bereits sehr konkret im Alltag. Dann fehlen etwa vollwertige Mahlzeiten, es gibt kein zweites Paar Schuhe, die Wohnung ist im Winter oft kalt, und selbst ein kurzer Urlaub ist nicht drin.
87 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen sagen laut Unicef-Bericht, dass sie häufig und sehr oft lachen und Spaß haben. Als "sehr gut" beschreibt die Hälfte der 9- bis 13-jährigen Kinder ihre Lebenszufriedenheit. Bei den 14- bis 17-Jährigen ist es dann nur noch ein Drittel.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1464 11-11-25: Mangelnde Unterstützung des Westens für die von Putins Rußland überfallene Ukraine wird sich rächen

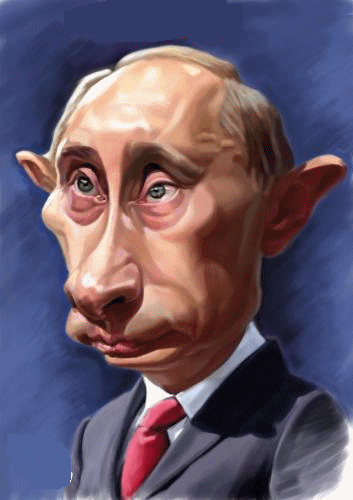
Verwundete Ukrainer können wegen der Bedrohung durch russische Drohnen kaum noch von der Front evakuiert werden. Laut Berichten breiten sich Krankheiten aus, die man vor allem aus dem Ersten Weltkrieg kennt. Die ukrainische Armee beklagt offenbar Fälle von seltenen Infektionskrankheiten wie Gasbrand. Das berichtet der britische "Telegraph" unter Berufung auf ungenannte ukrainische Militärangehörige. Die Evakuierung von Verletzten an der Front sei wegen der Bedrohung durch russische Drohnen "nahezu unmöglich" geworden, so der Bericht. Das begünstige die Ausbreitung von Infektionskrankheiten, die man historisch eher mit den Grabenkämpfen im Ersten Weltkrieg verbinde.
"Es kommen Menschen ins Krankenhaus, die seit einigen Wochen verletzt sind und einfach nur in unterirdischen Stabilisierungsstellen sitzen, wo sie so gut wie möglich am Leben gehalten werden", zitiert der "Telegraph" einen Sanitäter der ukrainischen Armee. Für eine angemessene Behandlung könne man sie nicht schnell genug in ein Krankenhaus bringen.
Gasbrand ist eine schwere Wundinfektion, bei der sich Gas bildet. Die Infektion "entsteht durch eine meist direkte Besiedlung von stark verschmutzten, zerstörten und zerklüfteten traumatischen oder chirurgischen Wunden", schreibt das Medizinlexikon Pschyrembel. Selbst mit medizinischer Versorgung stirbt laut Pschyrembel ein Drittel bis die Hälfte der Patienten. Ohne Behandlung sei die Sterberate nahe 100 Prozent, zitiert der "Telegraph" die Ärztin und Forscherin Lindsey Edwards vom King's College London.
Bereits 2022 während der Gefechte um Bachmut in der Ostukraine berichteten die westlichen Medien von Kämpfen wie im Ersten Weltkrieg: Die Grabenkämpfe führten mit Wintereinbruch zum sogenannten Schützengrabenfuß, "einem schmerzhaften Syndrom, das durch längere Kälte- und Nässeeinwirkungen entsteht". Aktuell ist die Lage der Ukraine im Donbass besonders schwierig: Die Eroberung von Pokrowsk und Myrnohrad scheint bevorzustehen, für Beobachter schienen die Lageberichte des ukrainischen Generalstabs zuletzt zweckoptimistisch. Der Militärexperte Franz-Stefan Gady warnt, dass die russische Armee den Donbass schon bald vollständig einnehmen könnte. Noch immer verweigert der Westen die Unterstützung durch weitreichende Raketen, die tief nach Rußland hinein fliegen könnten.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1463 10-11-25: Kohlenstoffdioxid (CO2) aus fossilen Brennstoffen und der Industrie Veränderung 2023 gegen 2015
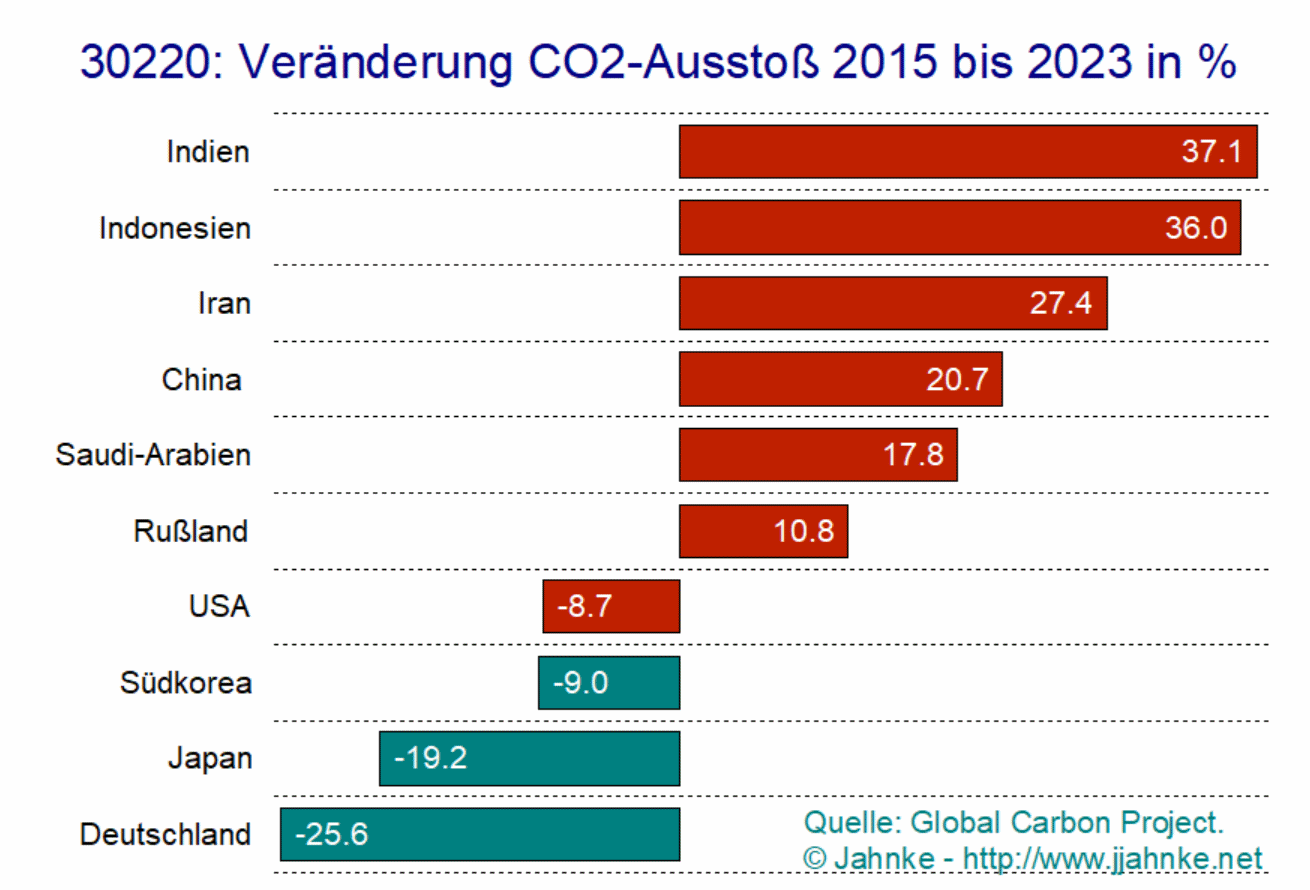
Der Ausstoß an klimaschädlichem CO2 hat sich seit 2015 sehr unterschiedlich entwickelt. Spitzenreiter beim Zuwachs ist Indien mit 37,1 %. Den größten Rückgang zwischen den größeren Industrieländern verzeichnet Deutschland mit minus 25,6 % (Abb. 30220).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1462 05-10-25: Putin läßt überall in der Ukraine morden

Den Strick hat er sich schon mehrfach verdient!
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1461 30-10-25: Männer sterben im Schnitt fast fünf Jahre früher als Frauen
Auch wenn sie im Schnitt insgesamt steigt: Männer haben in Deutschland eine um fast fünf Jahre geringere Lebenserwartung als Frauen. Bei ihnen liegt sie laut aktuellen Sterbetafeln des Statistischen Bundesamtes bei 78,5 Jahren, bei Frauen sind es 83,2 Jahre. Allerdings gleicht sich die Lebenserwartung demnach an: Laut Sterbetafeln stieg sie bei Männern in den vergangenen 20 Jahren um 2,6 Jahre, bei Frauen nur um 1,6 Jahre. Generell steigt die Lebenserwartung in Deutschland mit zunehmendem Wohlstand und besserer Gesundheitsversorgung.
Die geringere Lebenserwartung von Männern ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes eine Folge der generell höheren Sterblichkeit von Männern. Die Sterberate von Männern übertraf die der Frauen demnach teilweise stark. 15- bis 34-Jährige sterben demnach mehr als doppelt so wahrscheinlich wie Frauen, bei den 35- bis 84-Jährigen lag die Sterberate der Männer um 50 bis 85 Prozent höher, danach gleicht es sich an.
Ursache dafür sind unter anderem gesundheitsschädliche Gewohnheiten wie Rauchen oder Alkoholkonsum, die Männer öfter an den Tag legen, aber auch häufigere Unfälle oder Angriffe. So starben Männer 2024 unter anderem häufiger als Frauen an Herzinfarkten und anderen durchblutungsbedingten Herzkrankheiten sowie an Darm- und Lungenkrebs. Zudem starben sie öfter an Verletzungen, Vergiftungen und anderen äußeren Ursachen wie Unfällen und tätlichen Angriffen. Höher liegt die Sterberate bei Frauen dagegen bei psychischen Krankheiten.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1460 29-10-25: Israel mordet weiter: Mehr als 100 Tote nach neuerlichen israelischen Luftangriffen - und Deutschland liefert Waffen
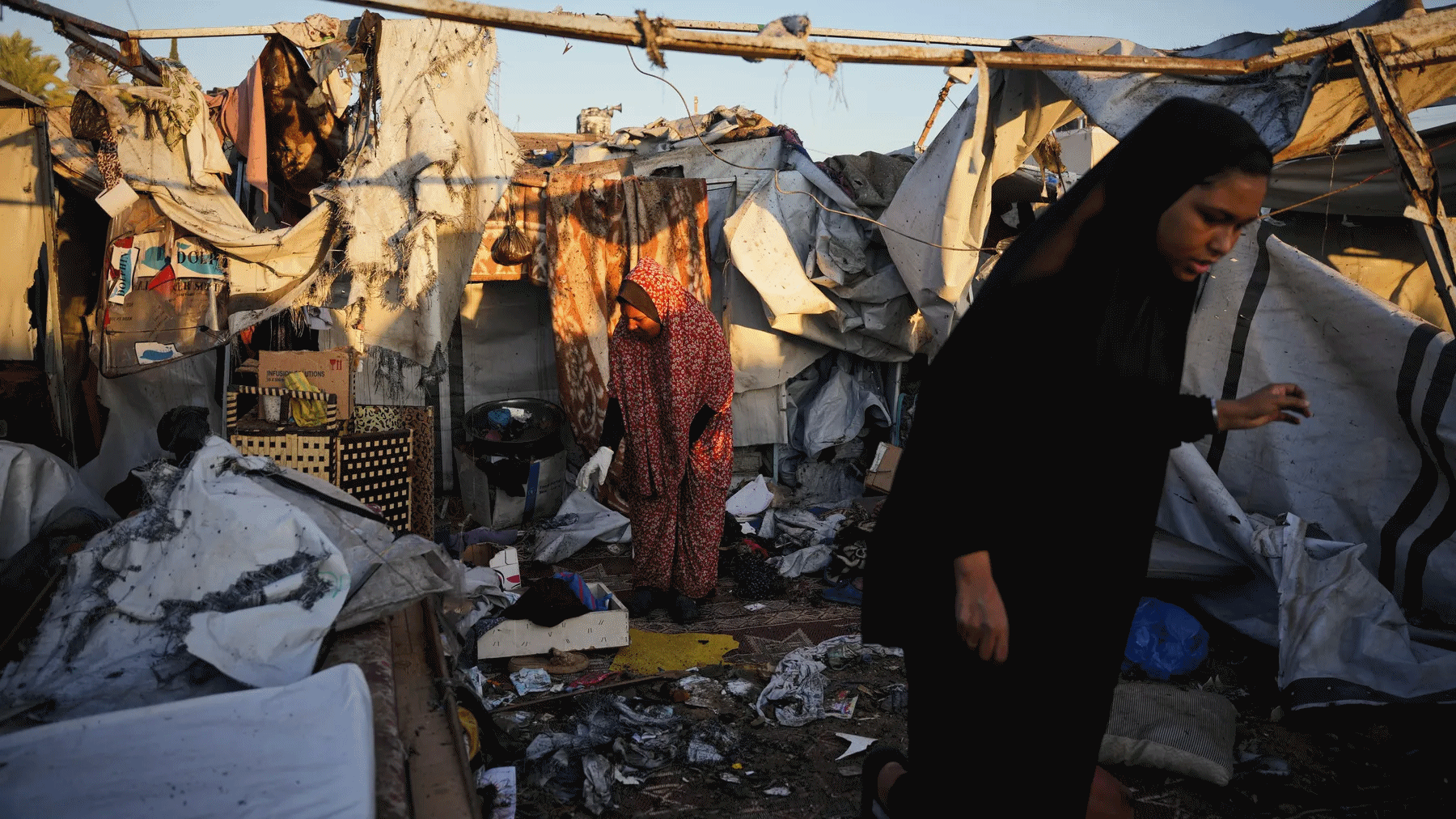
Bei den jüngsten Angriffen Israels auf Gaza sind nach palästinensischen Angaben 104 Menschen getötet worden. Darunter seien 46 Kinder gewesen, teilte die Gesundheitsbehörde in Gaza mit. Bei den Angriffen seien Dutzende Ziele angegriffen und 30 Terroristen getötet worden. Medienberichten zufolge wurde bei den Angriffen auch ein Flüchtlingscamp attackiert. Zu den Berichten darüber sowie zur Zahl der Getöteten äußerte sich das israelische Militär nicht.
Auslöser für die erneute Eskalation war laut Israel unter anderem ein Angriff von Hamas-Terroristen auf israelische Soldaten. Dabei war nach israelischen Angaben ein Reservist getötet worden. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte daraufhin sofortige "intensive Angriffe" auf Gaza angeordnet. Auch die schleppende Übergabe der sterblichen Überreste von israelischen Geiseln durch die Hamas sorgt in Israel für Ärger.
Die Bundesregierung hat trotz eines teilweisen Exportstopps erneut die Ausfuhr von Rüstungsgütern an Israel genehmigt und macht uns damit mit für das Morden in Gaza verantwortlich. Das geht aus einer Anfrage der Linken hervor.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1459 29-10-25: Laubbläser in Zürich nur noch eingeschränkt erlaubt - Warum nicht in Deutschland?

Laubbläser dürfen in Zürich bald nur noch elektrisch laufen - und das auch zeitlich beschränkt. In einer Volksabstimmung stimmte eine Mehrheit für restriktive Regeln. Sie sind laut, schaden der Tierwelt und sind schlecht für die Gesundheit - trotzdem sind Laubbläser ein beliebtes Gerät, um Wege oder Grünflächen von Laub zu befreien. In Zürich wird der Einsatz von Laubbläsern und Laubsaugern künftig stark eingeschränkt. Dafür haben sich knapp 62 Prozent der Bürgerinnen und Bürger in einer Volksabstimmung der größten Stadt der Schweiz ausgesprochen.
Demnach dürfen elektrisch betriebene Geräte nur noch von Oktober bis Dezember verwendet werden. In den anderen Monaten gibt es Ausnahmen, etwa für Bauarbeiten oder zum Saubermachen nach Großveranstaltungen. Benzinbetriebene Laubbläser und Laubsauger sind aus Lärmschutzgründen ab sofort nicht mehr erlaubt. Die Behörden reagieren damit auf die gängige Praxis, den Boden ganzjährig von Dreck und Unrat mit den Geräten zu befreien. Dabei wirbeln sie Feinstaub und Bakterien auf, was der Lunge schaden kann. Geräte mit Verbrennungsmotoren erzeugen Luftschadstoffe, die oft ungefiltert abgegeben werden. Einige Modelle der Laubbläser und -sauger sind teils so laut, dass sie bei langfristiger Beschallung dem Gehör schaden.
Besonders für Tiere sind die Geräte bedrohlich. Mit hohen Luftgeschwindigkeiten entfernen sie auch Kleinlebewesen vom Boden, die anderen Tieren als Nahrungsquelle dienen. Laubsauger verfügen außerdem häufig über einen Häcksler, der das Laub zerkleinert. Für Kleintiere wie Igel sind diese lebensbedrohlich.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1458 05-10-25: Immer mehr Demenz-Tote in Deutschland

Die Zahl der an Demenz verstorbenen Menschen in Deutschland ist weiter gestiegen. So wurden im Jahr 2024 nach den Ergebnissen der Todesursachenstatistik 61 927 Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung verursacht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 4,4 % mehr als im Vorjahr und 23,2 % mehr als im zehnjährigen Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024. Demenz in ihren verschiedenen Ausprägungen ist seit Jahren eine der häufigsten Todesursachen bei Frauen und nimmt auch bei Männern stetig zu. So war die Zahl der an Demenz verstorbenen Männer im Jahr 2024 mit 21 247 Verstorbenen um 27,9 % höher als im Zehnjahresdurchschnitt. Demgegenüber starben 40 680 Frauen an Demenz, das waren 20,8 % mehr als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2024.
Rund 89,1 % der im Jahr 2024 an Demenz Verstorbenen waren 80 Jahre und älter. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der durch Demenz verursachen Sterbefälle in der Altersgruppe ab 80 Jahren um 4,6 %. Im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt war dabei der Anstieg bei Männern ab 80 Jahren mit +32,9 % besonders stark, während der Anstieg bei Frauen derselben Altersgruppe nur bei 22,2 % lag.
Die häufigsten Todesursachen waren wie in den Vorjahren Krankheiten der Kreislaufsysteme (339 212) und bösartige Neubildungen (230 392) - an ihnen starben mit 56,5 % mehr als die Hälfte der Verstorbenen. Die Sterbefälle aufgrund von bösartigen Neubildungen, hierzu zählen sämtliche Krebsarten, blieben fast unverändert zum Vorjahr (+0,04 %). Bei den Krankheiten der Kreislaufsysteme, dazu zählen unter anderem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) und Schlaganfall, gab es einen leichten Rückgang (-2,6 %).
Krankheiten der Kreislaufsysteme und bösartige Neubildungen dominieren die Todesursachen auch bei einer getrennten Betrachtung nach Geschlecht: Zu den drei häufigsten Todesursachen von Männern zählen die chronische ischämische Herzkrankheit (39 765), bösartige Neubildungen der Bronchien und der Lunge (26 441) und der akute Myokardinfarkt (24 875). Die drei häufigsten Todesursachen von Frauen waren nicht näher bezeichnete Demenz (37 109), chronische ischämische Herzkrankheit (30 955) und Herzinsuffizienz (22 349).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1457 28-10-25: Fast Sparweltmeister
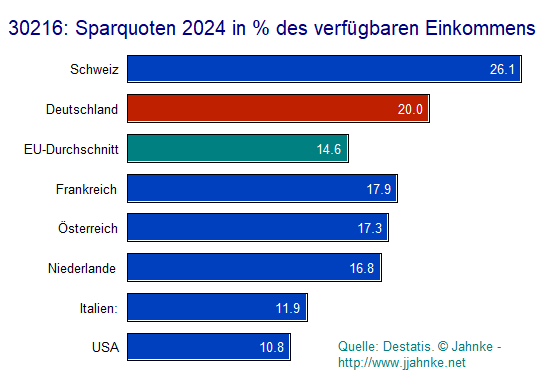
Die Deutschen sparen nach wie vor . 2024 betrug die Sparquote der privaten Haushalte in Deutschland 20 Prozent (Abb. 30216). Monatlich entspricht dies einem Betrag von durchschnittlich knapp 270 Euro je Einwohnerin und Einwohner, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1456 28-10-25: Putin vor 24 Jahren und heute


Dieses aktuelle Photo von Putin zeigt ihn mit verbissenem Gesicht im Kampfanzug. Kein Vergleich zu dem freundlichen Gesicht bei seiner Rede vor dem deutschen Bundestag vor 24 Jahren.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1455 25-10-25: Hass auf Israel? Nein, auf Juden! (aus "DIE ZEIT")
Der Antisemitismus war nie weg, doch seit dem Krieg in Gaza ist er auf einmal überall: auf Europas Straßen und an den Unis, auf Theaterbühnen und in den Köpfen der Jungen. Immer häufiger kommt es in Europa zu antisemitischen Straftaten - wie dem Anschlag auf diese Pariser Synagoge. Felix Klein, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, ist zuversichtlich. Er erwarte, dass die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Deutschland nun wieder zurückgehe, sagte er kürzlich dem Spiegel. Das war am 14. Oktober, vier Tage nachdem der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas in Kraft getreten war.
Vielleicht muss man als deutscher Antisemitismusbeauftragter in diesen Zeiten demonstrativ zuversichtlich sein, um nicht zu verzagen. Doch angesichts der Lage fällt Kleins Prognose überraschend optimistisch aus.
Der Krieg, den Israel gegen die Hamas führt und der nun - vorerst - durch einen brüchigen Waffenstillstand beendet ist, hat in Europa und den USA eine Welle von Antisemitismus ausgelöst: Immer wieder wurde auf Demonstrationen gegen den Krieg zur Vernichtung des jüdischen Staates aufgerufen, wurden jüdische Restaurants und Geschäfte beschmiert, Synagogen attackiert, Anschlagspläne vereitelt, die Auftritte von Künstlern abgesagt, Wissenschaftler ausgeladen. Juden wurden angegriffen, in einzelnen Fällen sogar getötet. Das alles auf europäischen Straßen, an amerikanischen Hochschulen, in Metropolen genauso wie auf dem Land.
Die Bilder des Kriegs haben sich tief in das kollektive Gedächtnis der westlichen Gesellschaften eingegraben: Knapp 70.000 Menschen sind laut palästinensischen Angaben von der israelischen Armee getötet worden, die Bilder abgemagerter Kinder, die Luftaufnahmen der Ruinen im Gazastreifen fanden Abend für Abend ihren Weg auf Millionen Smartphones und Fernsehbildschirme - zwei Jahre lang.
Protest auf den Straßen und in den Hörsälen, die Anerkennung Palästinas als souveräner Staat durch europäische Regierungen, sogar Ermittlungen wegen möglicher Kriegsverbrechen: All das gibt es, und es steckt dahinter nicht immer notwendigerweise ein antisemitisches Motiv, sondern auch nachvollziehbare Empörung, von der Meinungsfreiheit gedeckte Kritik oder schlicht der Anspruch zur Durchsetzung internationalen Rechts.
Und trotzdem: Der Antisemitismus im Westen ist seit dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen. Messbar in Form von Kriminalitätsstatistiken und wissenschaftlichen Untersuchungen. Und auch spürbar in Gesprächen am Arbeitsplatz, in WhatsApp-Chats und vor allem durch die Schilderungen von Jüdinnen und Juden in Europa und den USA, die einen neuen Alltag beschreiben, voller Einsamkeit und Angst.
"Israel hat kein Recht, zu existieren", sagt ein junger Brite, der eine Gesichtsmaske zu seinem schwarzen Leder-Outfit trägt. "Palästina war viele Jahrhunderte vorher da." Es ist Samstag, der 11. Oktober, die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas ist keine 24 Stunden alt. Über die Westminster Bridge am Fuße des Big Ben in London zieht ein Demonstrationszug. Zehntausende Menschen sind gekommen, wie so oft an den Wochenenden seit dem 7. Oktober 2023. Sie demonstrieren unter Palästinaflaggen, manche rufen "From the river to the sea!" Sie demonstrieren trotz der Waffenruhe, denn viele von ihnen glauben nicht, dass die Netanjahu-Regierung wirklich Frieden mit den Palästinensern will, und fordern ihrerseits die Vernichtung Israels. "Wir brauchen militärische Gewalt, um den israelischen Staat zu zerlegen", sagt Ousman Noor, Anführer des "Ein Staat Palästina"-Blocks, in einem Social-Media-Aufruf für den Marsch.
Wo endet legitime Kritik? Wo beginnt Antisemitismus? Wie hier in London mischen sich seit zwei Jahren die beiden Kategorien bei Demonstrationen überall in Europa und den USA.
Eindeutiger und noch schlimmer sind die Anschläge: In Manchester ermordete vor wenigen Wochen am jüdischen Feiertag Jom Kippur ein syrischstämmiger Brite zwei Juden vor einer Synagoge und verletzte drei weitere schwer.
In Washington, D. C. erschoss im Mai ein Mann aus nächster Nähe ein junges jüdisches Paar, Yaron Lischinsky und Sarah Milgrim. Die beiden hatten gerade eine Feier im Jüdischen Museum verlassen. Der Täter, ein Amerikaner, rief "Free Palestine!". Er hatte vor der Tat gepostet, das Vorgehen Israels in Gaza rechtfertige "bewaffnete Handlungen".
Auch in Frankreich kam es im vergangenen Jahr zu zwei Brandanschlägen auf Synagogen. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Ebenso in Berlin: Dort wurde Mitte Oktober 2023 versucht, einen Brandanschlag auf ein jüdisches Gemeindezentrum zu begehen. Die Brandsätze erloschen auf dem Bürgersteig.
Laut Behördenstatistiken schnellte die Zahl antisemitischer Straftaten in den vergangenen zwei Jahren insgesamt in die Höhe. Die Erhebungen sind wegen der unterschiedlichen Gesetzgebung und Erfassung schwer vergleichbar, der Trend allerdings geht in dieselbe Richtung: In Frankreich, dem Land, das mit rund 500.000 Personen die größte jüdische Gemeinde in Europa hat, registrierten die Sicherheitsbehörden 2024 insgesamt 1.570 antisemitische Straftaten, fast viermal so viele wie im Jahr 2022. Auch in Deutschland erreichten antisemitische Straftaten mit insgesamt 6.236 Delikten im Jahr 2024 einen neuen Höchststand, davon 148 Gewalttaten. In Großbritannien verdoppelten sich die Hassverbrechen gegen Juden laut dem britischen Innenministerium zwischen 2023 und 2024, von 1.543 Fällen auf 3.282, in Italien verdreifachten sie sich sogar. Nur in den USA fiel der Anstieg geringer aus: Das FBI registrierte von 2023 auf 2024 eine Zunahme um fünf Prozent.
Das Bedrohungsgefühl vieler Juden bilden die Statistiken aber ohnehin nur unzureichend ab. Für die USA etwa zeigt eine Studie des American Jewish Committee, dass 73 Prozent der Befragten sich 2024 weniger sicher fühlten als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, sie hätten aus Angst vor Übergriffen ihr Verhalten geändert und würden zum Beispiel in der Öffentlichkeit keine Kippa mehr tragen.
Auch in Deutschland gingen viele aus Angst nicht mehr mit Kippa oder Davidstern aus dem Haus, sagt Marina Chernivsky, die Geschäftsführerin von Ofek, einer Beratungsstelle für Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind. In Frankreich geben vier von fünf Jüdinnen und Juden an, sie hätten sich nach dem 7. Oktober in Frankreich "einsam" gefühlt. Dort nahm auch zwischen Oktober 2023 und August 2024 die Zahl jener französischen Juden massiv zu, die in Israel einen Antrag auf Einwanderung stellten. 7.000 waren es, im Vorjahr waren es nur 1.120. Wie viele tatsächlich auswanderten, ist nicht bekannt. In jedem Fall heißt es: Viele glaubten oder glauben, die Feindseligkeit könnte derart zunehmen, dass sie in Frankreich nicht mehr sicher sind.
Der Dauerdiskurs über den israelischen Krieg gegen die Hamas ist tief in die Gesellschaften eingedrungen, ist Teil des universitären Lebens geworden, sogar des Sports. Ebenso wie auf den Demonstrationen, wo sich legitime und antisemitische Rufe mischen, sind auch viele der politischen Debatten wichtig und legitim: über den Hunger als Waffe oder die Auseinandersetzung darüber, ob die israelische Regierung in Gaza einen Genozid begangen hat. Auch stellt sich die Frage, ob europäische Bürger etwa mit arabischem Migrationshintergrund auf dieselbe Weise zur Solidarität mit Israel verpflichtet sind, wie es die Politik und Gesellschaft zum Beispiel in Deutschland von ihren nicht migrantischen Bürgern einfordern, deren Eltern oder Großeltern eine aktive oder passive Rolle im Holocaust gespielt haben. Eine massive Fehlentwicklung jedoch zeigt sich in allen westlichen Gesellschaften: Die Wut und der Hass im öffentlichen Raum richten sich nicht nur gegen die israelische Regierung, sondern gegen einzelne Israelis und Juden. Besonders in der Kulturszene wurden sie in Kollektivhaft genommen. Diese Form des Antisemitismus ist in den vergangenen Jahren zu einem Teil der westlichen Popkultur geworden.
Während die über 1.200 am 7. Oktober Ermordeten und das Schicksal der Geiseln nach und nach in den Hintergrund traten, fand in der Kulturszene ein Überbietungswettbewerb der Solidarität mit den Menschen in Gaza statt. Oft war es echte humanitäre Sorge. Oft auch ein Vorwand für pauschale Boykotts gegen jüdische Künstler. Das jüngste Beispiel: Im September luden die Veranstalter eines Musikfestivals im flandrischen Gent die Münchner Philharmoniker aus. Ihr designierter israelischer Direktor Lahav Shani habe sich zwar, so hieß es in der Stellungnahme der Veranstalter, für Frieden und Versöhnung ausgesprochen. Aber er habe "seine Haltung zu dem genozidalen Regime in Tel Aviv" nicht klar genug zum Ausdruck gebracht.
"Viele Konzerte", sagt die Autorin Maria Kanitz, "werden zu regelrechten antisemitischen Erlösungsfeiern, bei denen Weltstars wie der US-Rapper Macklemore Fahnen schwenken oder sich mit der Kufiya durch die Menge tragen lassen." In ihrem kürzlich mit Lukas Geck veröffentlichten Buch Lauter Hass beschreiben die Autoren, wie Antisemitismus schon in den Jahren vor dem 7. Oktober die Musikszene durchzogen hat. Diese Tendenz, meinen die Autoren, habe sich während Israels Krieg gegen die Hamas verstärkt.
Die westlichen Gesellschaften eint zudem, dass der Protest innerhalb kürzester Zeit die Universitäten erreichte und dort schnell Grenzen überschritt. Vielleicht wird man rückblickend einmal sagen, dass es mit diesem Ereignis begann: Noch am 7. Oktober - als die Welt gerade erst begann, das Ausmaß des Hamas-Terrors zu begreifen - veröffentliche das Harvard Undergraduate Palestine Solidarity Committee ein Statement, in dem es erklärte, das "israelische Regime" sei "vollumfänglich verantwortlich für die Gewalt". Das Statement wurde zum Skandal, setzte aber gleichzeitig den Ton.
In den USA besetzten Studierende im Sommer 2024 an mehreren Universitäten Gebäude, ebenso an der Humboldt-Universität zu Berlin. Über Deutschland hinaus bekannt wurde der Fall des jüdischen Lehramtsstudenten Lahav Shapira, der nach einem Barbesuch von einem arabischstämmigen Kommilitonen ins Gesicht geschlagen und so gegen den Kopf getreten worden war, dass ihm mehrere Schädelknochen brachen. Im Mai vergangenen Jahres bezeichnete die britische Bildungsministerin Bridget Phillipson den stark zunehmenden Antisemitismus an britischen Universitäten als "nationalen Notstand".
Der Campus-Antisemitismus gehört zu jenen Phänomenen, die das Ende des Krieges in Gaza überdauern dürften. Schon vor dem 7. Oktober wurde Israel häufig mit den europäischen Kolonialmächten gleichgesetzt. Eine der Gründungsschriften der postkolonialen Studien, Edward Saids Orientalismus, ist eine Abrechnung mit der kulturellen und politischen Unterdrückung der arabischen Welt durch den Westen. Das Vorgehen der israelischen Armee empfanden viele Studierende als Bestätigung, dass Israel ein kolonialer Unterdrückerstaat sei. Zwei Jahre lang hat dieser Krieg eine ganze Generation angehender Akademiker geprägt und politisiert.
Ähnlich nachhaltig dürfte die Zunahme antisemitischer Einstellungen in der muslimischen Bevölkerung der westlichen Welt sein. Das Beispiel Frankreich ragt heraus. Während sich das Ausmaß antisemitischer Einstellungen seit dem 7. Oktober in der Gesamtbevölkerung kaum verändert hat, haben diese unter jungen Musliminnen und Muslimen in Frankreich noch einmal signifikant zugenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die liberale Stiftung Fondapol, die regelmäßig gemeinsam mit dem American Jewish Committee die Franzosen befragt. Und auch in Großbritannien hat der Gazakrieg eine Polarisierung in der Einwanderergesellschaft offengelegt - und eine Diskussion über langjährige politische Versäumnisse losgetreten. Die Institutionen des Landes, vor allem die konservative Regierung, die bis zum vergangenen Sommer 14 Jahre regierte, hätten die Entwicklung zu lange laufen lassen, sagen heute manche Torys selbstkritisch. Zu groß sei die Sorge gewesen, als "islamophob" gebrandmarkt zu werden.
Es ist ein Fazit, das deprimiert: Aktuell spricht wenig dafür, dass die Zuversicht des deutschen Antisemitismusbeauftragten Felix Klein berechtigt ist. Zu lange hat dieser Krieg gedauert, zu tief gehen die Wunden, zu brutal trat der Hass gegen Juden in den vergangenen Monaten zutage, als dass wie bei früheren heißen Phasen des Nahostkonflikts damit zu rechnen wäre, dass der Antisemitismus bald wieder abnimmt. Und das, obwohl der Krieg vorerst ruht.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1454 26-10-25: In Deutschland wird die psychische Gesundheit zunehmend eine Frage des Einkommens und der Bildung
Das zeigt eine Studie, die nun im Deutschen Ärzteblatt International erschienen ist. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Berliner Charité haben dafür die Daten von knapp 95.000 Menschen ausgewertet, sie reichen von 2019 bis 2024 und sind repräsentativ für Deutschland. Die Studie zeichnet nach, wie verbreitet depressive Symptome in der erwachsenen Bevölkerung sind - und zwar abhängig von Einkommen und Bildungsstand. Bildung und Einkommen hängen eng mit psychischer Gesundheit zusammen, das ist vielfach belegt. Armut erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression oder Angststörung zu erkranken, mitunter um das Dreifache. Sie zählt damit zu etablierten Risikofaktoren, wie etwa den Genen oder traumatischen Lebensereignissen.
Der Bevölkerungsanteil mit auffälliger Belastung durch depressive Symptome war in niedrigen Bildungs- und Einkommensgruppen durchgängig am höchsten. Der Anteil stieg insbesondere ab 2022 in den niedrigeren Bildungs- und Einkommensgruppen deutlich stärker als in den jeweils höheren sozioökonomischen Gruppen. Die absolute Ungleichheit (Anteilsdifferenz zwischen niedrigster und höchster Bildungs- beziehungsweise Einkommensposition) nahm von 10 (95-%-Konfidenzintervall: [7; 14] beziehungsweise 12 [7; 17]) Prozentpunkten in 2019 auf 22 [8; 36] beziehungsweise 30 [17; 44] Prozentpunkte in 2024 zu.
Schlussfolgerung: Die Ergebnisse zeigen einen Anstieg sozioökonomischer Ungleichheiten in der psychischen Belastung Erwachsener.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog1453 05-10-25: Putin mordet weiter in der Ukraine

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine fort. In der Hauptstadt Kyjiw sind nach nächtlichem Drohnenbeschuss drei Personen getötet und 29 weitere verletzt worden, wie der ukrainische Katastrophenschutzdienst mitteilte. Unter den Verletzten seien sechs Kinder, das jüngste sei vier Jahre alt, wie Kyjiws Bürgermeister Vitali Klitschko berichtet.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1452 26-10-25: Durch ihre Gaskäufe aus Russland bezahlt die EU Putins Krieg - und die Verteidigung der Ukraine zugleich
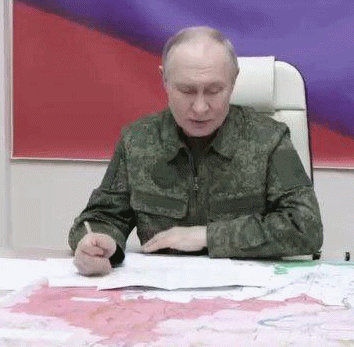
Die Europäische Union will am Neujahrstag 2027, also in einem Jahr und zwei Monaten, aufhören, Flüssiggas aus Russland zu kaufen. Das ist gut und schlecht zugleich. Gut ist, dass die Finanzierung des russischen Imperialismus stark reduziert werden soll. Schlecht ist, dass Wladimir Putin seinen Völkermord in der Ukraine jetzt noch volle vierzehn Monate lang auch mit europäischem Geld finanzieren kann.
Denn das tut er seit Jahren, trotz aller Sanktionen. Zwar sind die Gesamtimporte der EU aus Russland seit dem Überfall von 2022 um 89 Prozent zurückgegangen, aber der Rest ist immer noch gewaltig. Die größten Einnahmen erzielt Russland dabei durch den Verkauf von Flüssiggas, das mit Tankern von den arktischen Förderge-bieten Sibiriens durchs Eismeer nach Europa verschifft wird.
Was dann in den Gasterminals zwischen Huelva in Spanien und Klaipéda in Litauen ankommt, macht die EU bis heute zum größten Flüssiggaskunden Russlands - weit vor China und Japan. Und der Durst wächst stetig. In der ersten Hälfte des Jahres 2025 haben europäische Kunden deutlich mehr Flüssiggas aus Russland gekauft als noch vor einem Jahr.
Wie sie damit Putins Krieg finanzieren, hat Greenpeace im September ausgerechnet. Der russische Exportkonzern Yamal LNG hat demnach allein in den ersten drei Kriegsjahren Flüssiggas für 34 Milliarden Euro verkauft und 8,15 Milliarden als Steuer an den Staat abgeführt. Dafür kann die russische Führung neuneinhalb Millionen Artilleriegranaten des Standardkalibers 152 Millimeter beschaffen, also das Dreifache der aktuellen Jahresproduktion. Oder 271.000 jener Langstreckendrohnen, mit denen Putin ukrainische Familien im Schlaf tötet. Alternativ könnten auch knapp 2700 Panzer des Typs T-90M gekauft werden.
Zur Ehrenrettung Europas kann eingewandt werden, dass diese Zahlen sich auf die Gesamteinnahmen Russlands aus dem Flüssiggasexport beziehen. Hier ist neben Geld aus Europa auch solches aus China und anderen Ländern eingerechnet. Aber mindestens zwei Drittel der Summe kommen eben aus der EU. Vor allem Frankreich, Spanien, Belgien und die Niederlande scheinen geradezu süchtig nach russischem Gas zu sein. Folgt man den Zahlen von Greenpeace, haben sie seit 2022 deutlich mehr Gasgeld an Russland überwiesen als bilaterale Hilfen an die Ukraine.
Auch Deutschland spielt eine schlimme Rolle. Die Bundesregierung teilte im Sommer mit, das Staatsunternehmen SEFE, Nachfolger des 2022 verstaatlichten russischen Konzerns Gazprom Germania, werde allein im laufenden Jahr 50 Lieferungen aus der russischen Arktis erhalten. Geschätzter Wert: zwei Milliarden Euro.
Die EU steht nicht gut da. Aus Angst vor kurzfristigen Nachteilen, vor steigenden Energiepreisen, Inflation, Rezession und möglichen Vertragsstrafen haben viele Regierungen ihren Volkswirtschaften keinen kalten Entzug vom Gas zumuten wollen.
In der Folge hat das süchtige Europa seit 2022 ununterbrochen Milliarden in die russische Kriegswirtschaft geschaufelt und den Dealer Russland reicher und tödlicher gemacht. Es hat Putins Drohnen, Granaten und Panzer kofinanziert und ermöglicht damit bis heute seinen Feldzug gegen die Ukraine. Wer den Gedanken zu Ende denkt, entgeht nicht der Folgerung: Die Gaskunden in der EU bezahlen nicht nur Putins Soldaten, sondern auch seine Folterknechte und Vergewaltiger. Nebenher übrigens auch die Drohnen und Trollfarmen für seinen hybriden Krieg gegen Europa.
Zugleich haben die Länder der EU Milliarden in den Schutz der Ukraine gesteckt. In einem blutigen Paradox finanzierten sie damit sowohl die Täter als auch die Opfer in diesem verbrecherischen Krieg. Jeden Euro, den Europa zu sparen glaubte, indem es trotz Krieg weiter billiges russisches Gas kaufte, gab es sofort wieder aus, um den Terror zu verhindern, der durch dieses Geld erst möglich wurde. Das erinnert an Zbigniew Liberas Fotokunstwerk "People Burning Money", auf dem Passanten am helllichten Tag Geld verbrennen. Nur mit dem Unterschied, dass in der Ukraine auch Menschen brennen - in den Kampfgebieten und Kindergärten.
Die gleichzeitige Finanzierung Putins und der Ukraine belastet die Demokratie in Europa. Denn jeder Euro, den demokratische Nationen zur Abwehr einer Aggression ausgeben, die sie selbst finanzieren, fehlt ihnen bei Brücken, Renten und Krankenhäusern. Das alles will die EU jetzt beenden, aber warum eigentlich erst in vierzehn Monaten?
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1451 24-10-25: Wie gespalten ist Deutschland?
Die tatsächlichen Unterschiede in Einstellungen und Lebensrealitäten sind geringer, als viele meinen. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Studie von 2023 der Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westheuser. Demnach sei die gesellschaftliche Polarisierung in Deutschland in vielen Bereichen recht gering. Was uns trennt, sei weniger die soziale Wirklichkeit als die aufgeheizte Rhetorik darüber.
Laut der Studie herrscht bei vielen gesellschaftlichen Fragen überraschend breiter Konsens. Über Parteigrenzen und soziale Milieus hinweg seien sich die meisten einig: Die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen sei zu groß, Deutschland müsse mehr für den Klimaschutz tun, und Zuwanderung bereichere das kulturelle Leben.
Vieles spricht dafür, dass die Ängste und Sorgen vieler Menschen aus den realen Erfahrungen ihres Alltags erwachsen: 85 Prozent der Deutschen sind überzeugt, dass die Zukunft schlechter werden wird, dass es künftigen Generationen nicht mehr so gut gehen wird, wie es der heutigen älteren Generation geht und in den letzten Jahrzehnten ergangen ist. Seit jeher sehen viele das Aufstiegsversprechen als essenziellen Teil des Gesellschaftsvertrags: Den eigenen Kindern und Enkelkindern soll es einmal besser gehen, nicht schlechter.
In der Realität hat die soziale Polarisierung zugenommen und heute ein beachtliches Maß erreicht: 40 Prozent der Menschen in Deutschland haben praktisch keine Ersparnisse, keine Vorsorge oder Absicherung für Krisen. Dies macht sie abhängig vom Sozialstaat. Die von vielen als Almosen wahrgenommenen sozialen Leistungen sind immer stärker mit einem Stigma verbunden. 60 Prozent der von Armut bedrohten Rentner und Rentnerinnen nehmen ihren Anspruch auf Grundsicherung nicht wahr - nicht aus Unwissen, sondern primär aus Scham und Selbstrespekt.
Zu Recht kritisiert die Studie: Einige Akteure in Politik und Medien schüren gezielt Phantomdebatten, um gesellschaftliche Spannungen zu verstärken und Menschen gegeneinander auszuspielen. Nutznießer dieser Strategie sind vor allem extreme Parteien und populistische Bewegungen. Doch auch demokratische Kräfte greifen zunehmend zu diesen Mitteln: Einzelne Vorfälle werden überhöht dargestellt, um ganze Gruppen unter Generalverdacht zu stellen. Geflüchtete gelten pauschal als Belastung für das Sozialsystem. Klimaaktivisten werden pauschal als Terroristen diffamiert. Solche Narrative emotionalisieren, polarisieren - und verzerren die Realität.
Wenn immer mehr Menschen in Deutschland behaupten, die Demokratie funktioniere für sie nicht, dann sollten wir diese Menschen nicht als Opfer von Gehirnwäsche und Rechtsextremismus abtun, sondern ihre Wahrnehmung ernst nehmen. Viele fühlen sich nicht nur in ihren Freiheiten beschränkt, sie sind es auch. So sind zum Beispiel die Bildungschancen in Deutschland ungleich verteilt. Viele fühlen sich mit ihren Sorgen nicht ernst genommen und gerade Menschen in strukturschwächeren Regionen sehen, wie essenzielle Dinge der Daseinsfürsorge - von Ärzten und Apotheken, Schulen, Vereinen und Gaststätten - verschwinden.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1450 24-10-25: Im deutschen Stadtbild Probleme im Zusammenhang mit Migration
Eine Mehrheit der Deutschen stimmt der Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu, dass es im deutschen Stadtbild Probleme im Zusammenhang mit Migration gebe. Im aktuellen ZDF-Politbarometer wurde die entsprechende Frage ausdrücklich gestellt zu Merz’ präzisierter Aussage, wonach es vor allem bei Personen ohne dauerhaften Aufenthaltsstatus, die nicht arbeiten und sich nicht an Regeln halten, Schwierigkeiten gebe. Laut Umfrage teilen 63 Prozent der Befragten – darunter deutlich mehr Ältere als Jüngere – diese Einschätzung des Kanzlers.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1449 22-10-25: Immer mehr Milliardäre in Deutschland - Das größte addierte Mlliardenvermögen W-Europas in Deutschland - +42 % Milliardäre seit 2015
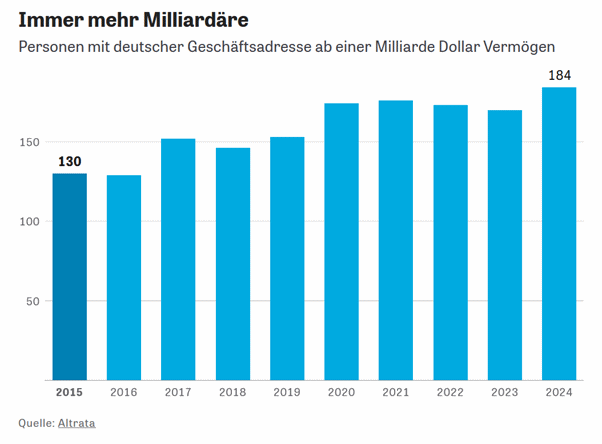
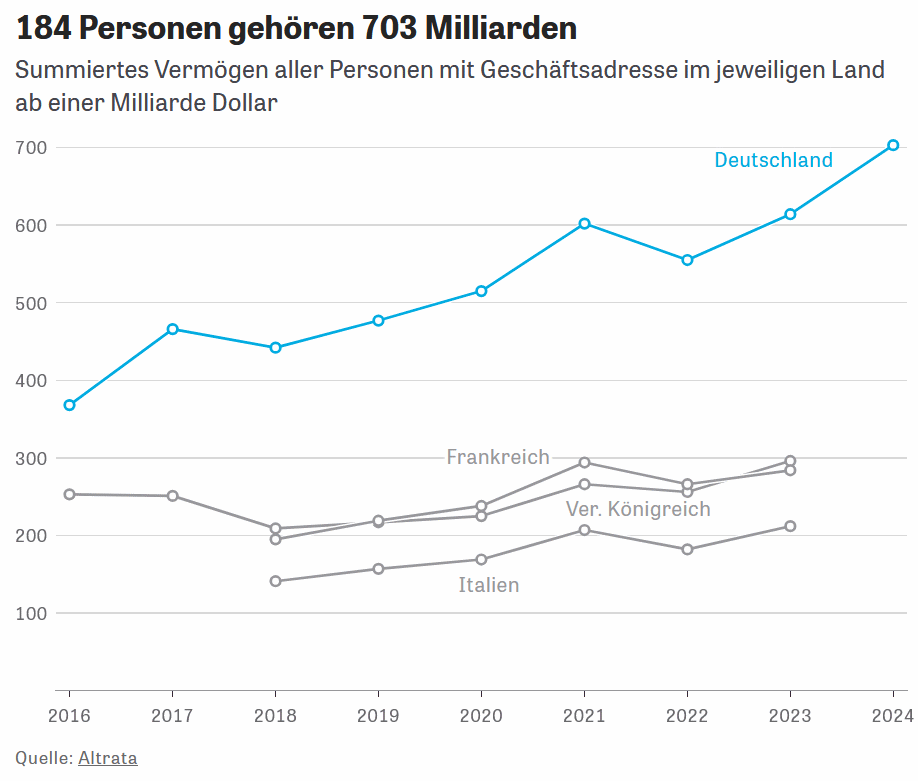
In Deutschland gibt es 184 Milliardäre. Die meisten leben so diskret, dass Forscher ihr schnell wachsendes Vermögen oft nur ungefähr schätzen können. Im Vergleich zu 2015 sind 54 Milliardäre dazugekommen, etwa fünf pro Jahr. In keinem anderen europäischen Land wächst ihre Zahl so stark. Weltweit ist Deutschland mittlerweile das Land mit den drittmeisten Milliardären. Sie haben zusammen 703 Milliarden Dollar, etwa 603 Milliarden Euro. Mehr als das Bruttoinlandsprodukt von Österreich und ein Drittel mehr als die ärmeren 50 Prozent der Deutschen, knapp 41 Millionen Menschen. Mit dem Geld könnte man fast 700 mal die Elbphilharmonie bauen. Die reichste Person ist Lidl-Gründer Dieter Schwarz, reichste Frau BMW-Erbin Susanne Klatten. Jüngster Milliardär ist dm-Erbe Kevin Lehmann (23), die älteste Eva Madelung (93), Tochter von Robert Bosch. Klicken Sie auf die umrandeten Köpfe für weitere Informationen. Der Frauenanteil liegt bei 22,3 Prozent. Es gibt 41 Milliardärinnen, darunter Susanne Klatten, Aldi-Erbin Beate Heister oder Nadia Thiele. Familie Thiele zahlte mutmaßlich erst kürzlich vier Milliarden Euro Erbschaftsteuer, weil eine Stiftung zu spät gegründet wurde.
Nach Alter sortiert sieht man, dass die meisten Milliardäre zwischen 60 und 80 Jahre alt sind. Nur elf sind jünger als 40, sie besitzen zusammen 22 Milliarden Dollar. Ein Vermögen über zehn Milliarden haben nur Milliardäre ab 50. Die meisten Milliardäre, insgesamt 41, kommen aus Nordrhein-Westfalen. Aber Hamburg hat mit 18 Milliardären und 1,8 Mio. Einwohnern die höchste Dichte: rund zehn Milliardäre pro eine Million Einwohner. Gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Der Anteil an Milliardären, die nicht geerbt haben, liegt bei 18 Prozent. Knapp 17 Prozent sind allein durch ein Erbe zum Milliardär geworden, und 65 Prozent verdanken ihr Vermögen einer Mischung aus Erbschaft und eigener Anstrengung. Die meisten Unternehmer unter den Milliardären, knapp 17 Prozent, sind im Gesundheitssektor tätig oder führen ein Unternehmen in dieser Branche. Gefolgt von der Lebensmittelindustrie, der Fertigung und dem Bank- sowie Finanzsektor. Nur 27 Milliardäre haben ihr Unternehmen an der Börse notiert, während die übrigen Unternehmen privat sind. Die Mehrheit der Privatunternehmen sind Familienunternehmen wie Bosch, Aldi oder Rossmann.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1448 21-10-25: Die Barbaren von heute sind im Kreml zu Hause
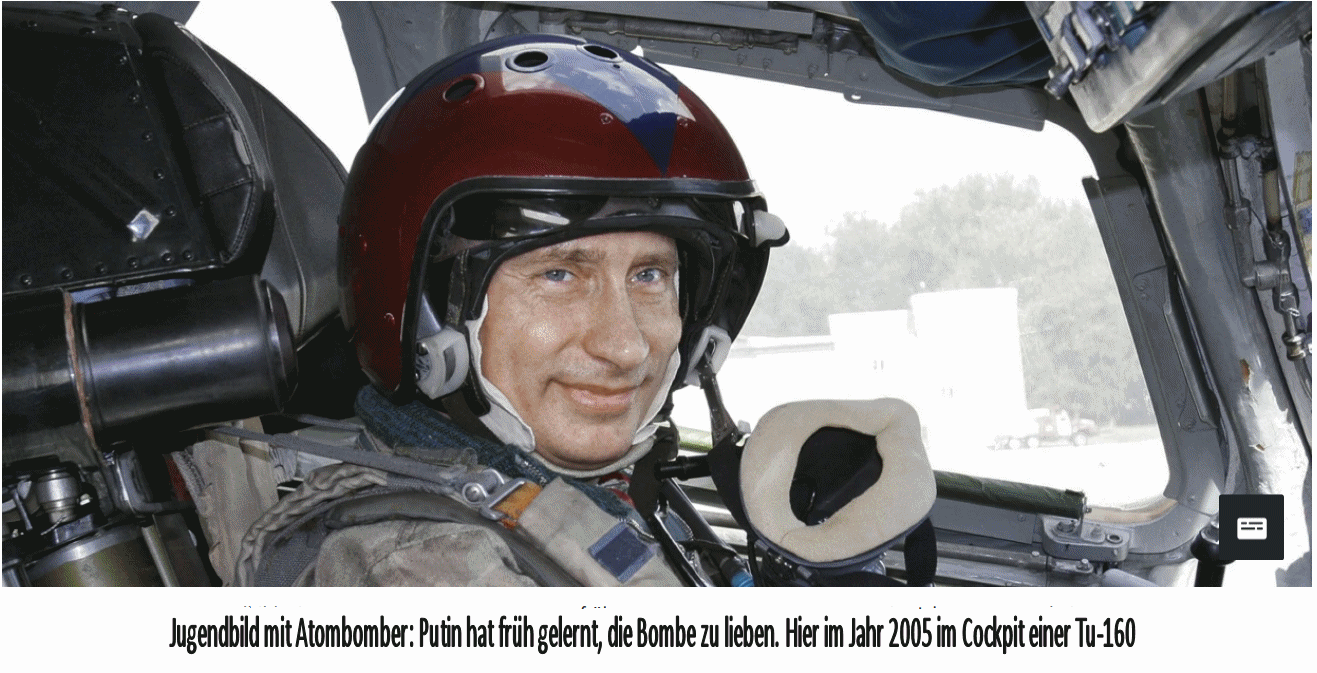
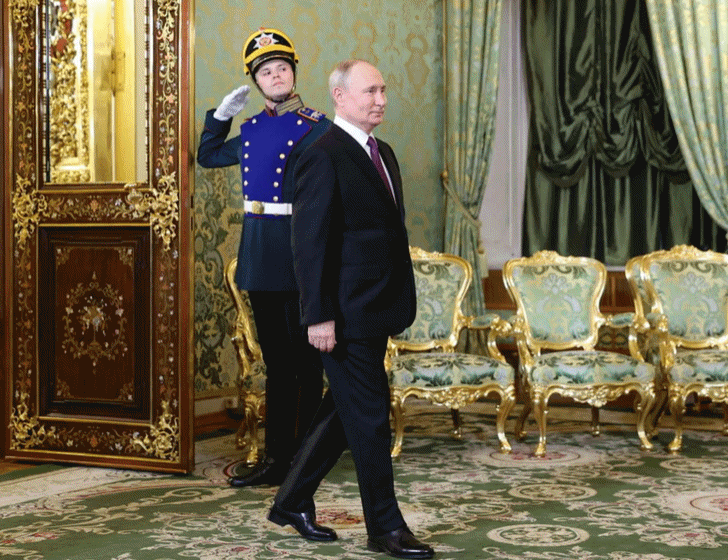
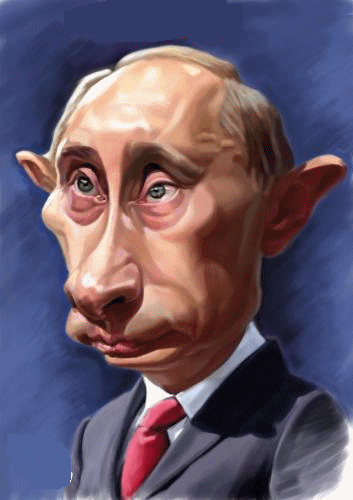
Russland zielt erneut auf die ukrainische Infrastruktur. Im Norden des Landes ist für viele Menschen nach einem Angriff der Strom ausgefallen, die Wasserversorgung unsicher. Nach einem russischen Angriff auf die nordukrainische Region Tschernihiw sind Hunderttausende Menschen ohne Elektrizität. Komplette Stromausfälle gibt es den ukrainischen Behörden zufolge im nördlichen Teil der Region Tschernihiw sowie in der gleichnamigen Regionalhauptstadt, die vor Beginn des Krieges 280.000 Einwohner zählte. Russische Drohnen stören wohl die Aufräumarbeiten.
Nachdem in den vergangenen Tagen bereits mehrfach wichtige Versorgungsinfrastruktur in Tschernihiw attackiert wurde, hat Russland in der Nacht die Ukraine erneut mit Angriffen aus der Luft überzogen. In der südukrainischen Stadt Cherson wurden drei Menschen bei Drohnenangriffen verletzt. An den Einschlagsorten seien Feuer ausgebrochen. Wohngebäude, eine Bildungseinrichtung und ein Wirtschaftsgebäude seien beschädigt worden. Russland lasse absichtlich Drohnen über die beschädigten Infrastrukturanlagen kreisen, um Reparaturen unmöglich zu machen und "die humanitäre Krise bewusst zu verlängern", erklärte das ukrainische Energieministerium auf der Plattform Telegram.
Der kommunale Wasserversorger Tschernihiwwodokanal schrieb bei Telegram, dass seine Anlagen "wie die ganze Stadt" ohne Strom seien, und forderte Menschen auf, rechtzeitig Wasservorräte anzulegen. Mitarbeiter hätten am Morgen begonnen, die Anlagen aus alternativen Stromquellen zu betreiben. Die Wasserversorgung der ersten Stockwerke in Mehrfamilienhäusern sei garantiert, in den oberen Stockwerken hänge sie vom Gelände ab. In der Nähe von Wohnblocks seien Zapfstellen eingerichtet und in manche Stadtteile Wasserlieferungen organisiert worden.
Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Derweil sieht es so aus, dass es nach der Verabredung von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin für ein Treffen in Budapest zu Verzögerungen kommt. Das russische Außenministerium deutet an, dass sich das Vorbereitungstreffen der beiden Außenminister Marco Rubio und Sergej Lawrow verzögern könnte.
Für eine Begegnung mit Rubio seien Vorbereitungen notwendig, sagt der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow der Agentur Ria Novosti. Rubio und Lawrow hatten am Montag telefoniert. Dieses Gespräch werde nun nachbereitet, erklärt Rjabkow. Aber über ein Treffen der beiden Minister sei nicht speziell beraten worden. Zu Berichten, dass die Zusammenkunft Rubios mit Lawrow verschoben worden sei, erklärt das russische Außenministerium, man könne nichts verschieben, das nicht vereinbart worden sei. Das Vorbereitungstreffen der beiden Außenminister galt als zentraler Schritt hin zu einer Begegnung Trumps und Putins.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1447 19-10-25: In Deutschland wird die psychische Gesundheit zunehmend eine Frage des Einkommens und der Bildung
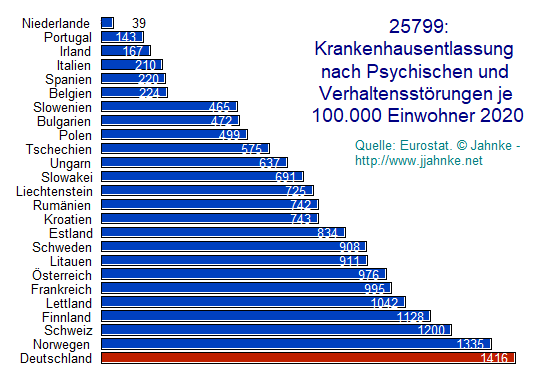
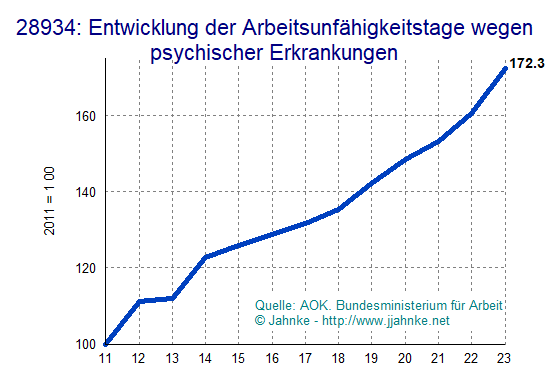

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Berliner Charité haben dafür die Daten von knapp 95.000 Menschen ausgewertet, sie reichen von 2019 bis 2024 und sind repräsentativ für Deutschland.
Die Studie zeichnet nach, wie verbreitet depressive Symptome in der erwachsenen Bevölkerung sind - und zwar abhängig von Einkommen und Bildungsstand. Wichtig ist: Erfasst wurde nicht, ob jemand an einer diagnostizierten Depression leidet. Stattdessen verwendeten die Forschenden einen knappen Fragebogen, der erste Anzeichen einer Depression aufdecken kann, nämlich über zwei Kernsymptome: Interessenverlust und depressive Verstimmung. Grundsätzlich kann man sagen, dass es immer mehr Deutschen psychisch schlecht geht - aber nicht allen gleichermaßen.
Mehr Menschen berichten über depressive Symptome
Schon 2019, als die Erhebung begann, unterschieden sich Menschen mit niedrigem Einkommen und niedriger Bildung von Menschen mit höherem sozioökonomischem Status. Wer früher von der Schule abgegangen war und weniger Geld verdiente, berichtete häufiger von depressiven Symptomen.
In den ersten Jahren der Coronapandemie, 2020 und 2021, nahm die psychische Belastung über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu. Bis 2022 - in diesem Jahr entkoppelten sich die Pfade. Unter den reichen, besser gebildeten Menschen fühlen sich seitdem etwas mehr Menschen als zuvor depressiv. Unter den ärmeren, schlechter gebildeten sind es sehr viel mehr. Der Abstand zwischen den beiden Gruppen hat sich in nur fünf Jahren deutlich vergrößert, die Ungleichheit ist gewachsen.
Von Menschen mit hohem Einkommen gaben 2019 sechs Prozent an, unter depressiven Symptomen zu leiden, 2024 waren es gut acht Prozent. Bei Menschen mit niedrigem Einkommen zeigte sich dagegen ein dramatischer Anstieg von 16 auf fast 33 Prozent.
Wie es um die seelische Gesundheit bestellt ist, hängt in Deutschland zunehmend von Einkommen und Bildung ab - so muss man die Ergebnisse interpretieren. Die Verfasser der Studie, aber auch unabhängige Forscherinnen und Forscher, sehen darin eine besorgniserregende Entwicklung. Es sei zwar bekannt, dass depressive Symptome in der Bevölkerung seit einigen Jahren zunehmen, sagt Nico Dragano, Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie am Uniklinikum Düsseldorf, dem Science Media Center (SMC). Bekannt sei auch, dass Menschen mit niedrigem Einkommen davon häufiger betroffen sind. "Dass die Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen aktuell aber weiter ansteigen, ist eine neue und wichtige Information."
Bildung und Einkommen hängen eng mit psychischer Gesundheit zusammen, das ist vielfach belegt. Armut erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression oder Angststörung zu erkranken, mitunter um das Dreifache. Sie zählt damit zu etablierten Risikofaktoren, wie etwa den Genen oder traumatischen Lebensereignissen.
Warum und wie genau ein niedriger sozioökonomischer Status Menschen anfälliger für psychische Belastung macht, ist nicht leicht zu untersuchen - schließlich kann man Gehalt oder Bildungsniveau in Experimenten nicht einfach zuteilen und anschließend die Menschen im Labor beobachten. Studienteilnehmer bringen ihr Einkommen und ihre Abschlüsse immer schon mit in die Untersuchung, was eindeutige Kausalschlüsse erschwert.
Armut und psychische Gesundheit: Die Unversorgten
Dennoch gilt eine Reihe von Erklärungen, wie Armut auf die Psyche schlägt, als gesichert. Schon wie und wo jemand wohnt, kann das psychische Wohlbefinden beeinflussen: Ärmere Menschen leben öfter in schlecht isolierten Wohnungen, die im Winter abkühlen, im Sommer aufheizen und in denen es tags wie nachts laut sein kann, weil günstige Wohnungen häufiger an großen, viel befahrenen Straßen liegen. All das laugt aus, stört den Schlaf - und verursacht Stress. Eine wichtige Rolle spielen außerdem Geldsorgen, vielleicht auch Schulden oder Arbeitslosigkeit. Sie lösen nicht nur Stress und Existenzängste aus, sondern versperren auch den Zugang zu Teilhabe: Wer kein Geld für eine Klassenfahrt hat, einen Schwimmkurs, einen Kinobesuch, fühlt sich nicht nur ausgeschlossen, sondern ist es auch. Schon bei Kindern hinterlässt Armut Spuren, sogar im Gehirn.
Ein niedriger sozioökonomischer Status geht nicht nur mit mehr Belastungen einher - sondern auch mit weniger Ressourcen, um sie auszugleichen. Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen erleben sich zum Beispiel als weniger selbstwirksam, sie glauben weniger daran, ihr Leben und ihr Befinden beeinflussen zu können. Sie suchen sich auch seltener Hilfe, aus Mangel an Aufklärung oder aus Scham. "Depressionssymptome und andere psychische Symptome und Erkrankungen werden weniger häufig von benachteiligten Menschen angegangen", sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie dem Science Media Center.
In krisenhaften Zeiten können sich all diese Faktoren verschärfen und dazu beitragen, dass es Menschen psychisch deutlich schlechter geht. Sozioökonomisch schlechter gestellte Menschen sind dafür eher anfällig, das stellten Forscher zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008 fest. Und auch die Ergebnisse der aktuellen Studie lassen sich wohl am ehesten dadurch erklären: mit den Krisen der vergangenen Jahre.
Die Daten des RKI liefern zwar keine Gründe, warum sich die psychische Belastung so zugespitzt hat, gerade bei sozial benachteiligten Menschen. Die Autorinnen und Autoren äußern aber Vermutungen: Wenn man auf die Jahre zurückschaut, haben gleich mehrere Zäsuren den Alltag der Deutschen geprägt. Zunächst die Coronapandemie, während der Menschen ihre Jobs verloren, in Kurzarbeit gingen und ihre Kinder zu Hause betreuen mussten, weil Schulen und Kitas zeitweise geschlossen waren. Ab 2022 kam der russische Angriffskrieg in der Ukraine dazu, der bei vielen Menschen Sorgen auslöste, dazu kamen rapide steigende Energiekosten und Lebensmittelpreise. "Schulden, Existenza?ngste sowie Geldmangel sind Risikofaktoren fu?r Depressionen oder Angststo?rungen", sagt Nico Dragano. "Wa?hrend der Pandemie und spa?ter wa?hrend der Zeit starker Inflation sind diese Belastungen ha?ufiger geworden, was den Trend mit erkla?ren ko?nnte."
Das Tragische dabei: Menschen, die wenig Geld haben, sind diesen Einflüssen oft ausgesetzt, ohne etwas dagegen tun zu können. "Wir sprechen hier von sogenannten 'sozialen Determinanten der Gesundheit', die man selbst kaum beeinflussen kann", sagt Verina Wild, Leiterin des Instituts für Ethik und Geschichte der Gesundheit in der Gesellschaft an der Universität Augsburg. Der Haushalt, in den man hineingeboren wird, das Viertel, in dem man aufwächst, die Unterstützung, die man während der Schule bekommt, die Wohnung, die man sich als Erwachsener leisten kann, die Zeit, die für Self-Care und Auszeiten bleibt: All das sind Faktoren, die für viele Menschen oft schon in der Kindheit vorgezeichnet sind und die in der Regel außerhalb des eigenen Handlungsspielraums liegen. "Eigenverantwortung und individuelle Gesundheitskompetenz kommen da ganz klar an ihre Grenzen", sagt Wild.
Letztlich bedeutet das: Wenn sich die Lücke wieder verkleinern soll, muss vor allem die Politik handeln, da sind sich Fachleute einig. Es sei eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe, die Verhältnisse zu verbessern, in denen wir leben, sagt Verina Wild. "Also zum Beispiel Wohnungen und Wohnumgebungen, Arbeitsplätze, Freizeitangebote, soziale Anbindung, gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung." Und Nico Dragano sagt: "Wir fordern schon seit Jahren, dass sich Deutschland eine echte Strategie zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit gibt. Ideen wären da, nur die Umsetzung erfolgt nicht.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1446 19-10-25: Israel fliegt offenbar wieder Luftangriffe in Gaza
Das israelische Militär hat nach Berichten israelischer Medien Luftangriffe im Süden des Gazastreifens durchgeführt. Bei den Angriffen im Gebiet von Rafah handelt es sich um eine Reaktion auf einen Verstoß gegen die Waffenruhe von palästinensischer Seite, wie die Times of Israel berichtete. Auch der Fernsehsender Channel 12 berichtete von den israelischen Luftangriffen. Diese Luftangriffe sind mörderisch und völkerrechtswidrig.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1445 19-10-25: Deutsche Geburtenrate - eine der drei letzten unter den Industrieländern
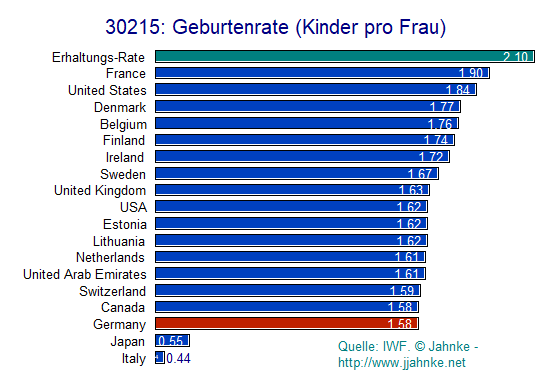
Die deutsche Geburtenrate liegt mit 1,58 Kindern pro Frau weit unter der Bevölkerungserhaltungsrate von 2,10 und unter den drei niedrigsten der 16 westlichen Industrieländer (Abb. 30215). Das ein miserables Zeichen für die Gemütslage der Nation!
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1444 17-10-25: Psychisch belasteter denn je - Mehr Menschen berichten über depressive Symptome
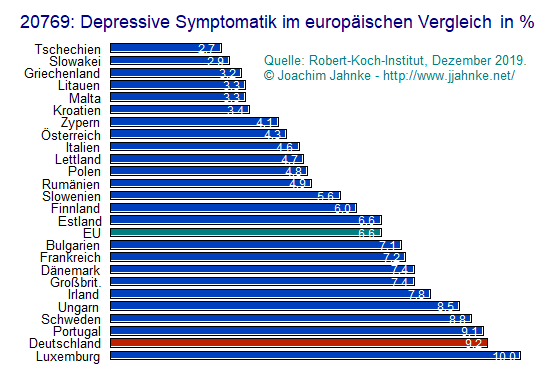
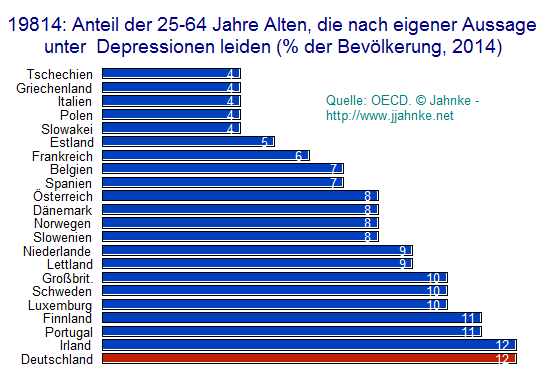
Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich depressiv. Neue Daten zeigen, wie ungleich die Last in der Bevölkerung verteilt ist und wer besonders unter Krisen leidet.
Wie das Geld ist auch das Glück nicht gleich verteilt auf dieser Welt. In Deutschland wird die psychische Gesundheit zunehmend eine Frage des Einkommens und der Bildung. Das zeigt eine Studie, die nun im Deutschen Ärzteblatt International erschienen ist. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Robert Koch-Instituts (RKI) und der Berliner Charité haben dafür die Daten von knapp 95.000 Menschen ausgewertet, sie reichen von 2019 bis 2024 und sind repräsentativ für Deutschland.
Die Studie zeichnet nach, wie verbreitet depressive Symptome in der erwachsenen Bevölkerung sind - und zwar abhängig von Einkommen und Bildungsstand. Wichtig ist: Erfasst wurde nicht, ob jemand an einer diagnostizierten Depression leidet. Stattdessen verwendeten die Forschenden einen knappen Fragebogen, der erste Anzeichen einer Depression aufdecken kann, nämlich über zwei Kernsymptome: Interessenverlust und depressive Verstimmung. Grundsätzlich kann man sagen, dass es immer mehr Deutschen psychisch schlecht geht - aber nicht allen gleichermaßen.
Schon 2019, als die Erhebung begann, unterschieden sich Menschen mit niedrigem Einkommen und niedriger Bildung von Menschen mit höherem sozioökonomischem Status. Wer früher von der Schule abgegangen war und weniger Geld verdiente, berichtete häufiger von depressiven Symptomen.
In den ersten Jahren der Coronapandemie, 2020 und 2021, nahm die psychische Belastung über alle Bevölkerungsgruppen hinweg zu. Bis 2022 - in diesem Jahr entkoppelten sich die Pfade. Unter den reichen, besser gebildeten Menschen fühlen sich seitdem etwas mehr Menschen als zuvor depressiv. Unter den ärmeren, schlechter gebildeten sind es sehr viel mehr. Der Abstand zwischen den beiden Gruppen hat sich in nur fünf Jahren deutlich vergrößert, die Ungleichheit ist gewachsen.
Von Menschen mit hohem Einkommen gaben 2019 sechs Prozent an, unter depressiven Symptomen zu leiden, 2024 waren es gut acht Prozent. Bei Menschen mit niedrigem Einkommen zeigte sich dagegen ein dramatischer Anstieg von 16 auf fast 33 Prozent.
Wie es um die seelische Gesundheit bestellt ist, hängt in Deutschland zunehmend von Einkommen und Bildung ab - so muss man die Ergebnisse interpretieren.
Die Verfasser der Studie, aber auch unabhängige Forscherinnen und Forscher, sehen darin eine besorgniserregende Entwicklung. Es sei zwar bekannt, dass depressive Symptome in der Bevölkerung seit einigen Jahren zunehmen, sagt Nico Dragano, Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie am Uniklinikum Düsseldorf, dem Science Media Center (SMC). Bekannt sei auch, dass Menschen mit niedrigem Einkommen davon häufiger betroffen sind. "Dass die Unterschiede zwischen den sozialen Gruppen aktuell aber weiter ansteigen, ist eine neue und wichtige Information."
Bildung und Einkommen hängen eng mit psychischer Gesundheit zusammen, das ist vielfach belegt. Armut erhöht die Wahrscheinlichkeit, an einer Depression oder Angststörung zu erkranken, mitunter um das Dreifache. Sie zählt damit zu etablierten Risikofaktoren, wie etwa den Genen oder traumatischen Lebensereignissen. Warum und wie genau ein niedriger sozioökonomischer Status Menschen anfälliger für psychische Belastung macht, ist nicht leicht zu untersuchen - schließlich kann man Gehalt oder Bildungsniveau in Experimenten nicht einfach zuteilen und anschließend die Menschen im Labor beobachten. Studienteilnehmer bringen ihr Einkommen und ihre Abschlüsse immer schon mit in die Untersuchung, was eindeutige Kausalschlüsse erschwert.
Dennoch gilt eine Reihe von Erklärungen, wie Armut auf die Psyche schlägt, als gesichert. Schon wie und wo jemand wohnt, kann das psychische Wohlbefinden beeinflussen: Ärmere Menschen leben öfter in schlecht isolierten Wohnungen, die im Winter abkühlen, im Sommer aufheizen und in denen es tags wie nachts laut sein kann, weil günstige Wohnungen häufiger an großen, viel befahrenen Straßen liegen. All das laugt aus, stört den Schlaf - und verursacht Stress. Eine wichtige Rolle spielen außerdem Geldsorgen, vielleicht auch Schulden oder Arbeitslosigkeit. Sie lösen nicht nur Stress und Existenzängste aus, sondern versperren auch den Zugang zu Teilhabe: Wer kein Geld für eine Klassenfahrt hat, einen Schwimmkurs, einen Kinobesuch, fühlt sich nicht nur ausgeschlossen, sondern ist es auch. Schon bei Kindern hinterlässt Armut Spuren, sogar im Gehirn.
Ein niedriger sozioökonomischer Status geht nicht nur mit mehr Belastungen einher - sondern auch mit weniger Ressourcen, um sie auszugleichen. Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen erleben sich zum Beispiel als weniger selbstwirksam, sie glauben weniger daran, ihr Leben und ihr Befinden beeinflussen zu können. Sie suchen sich auch seltener Hilfe, aus Mangel an Aufklärung oder aus Scham. "Depressionssymptome und andere psychische Symptome und Erkrankungen werden weniger häufig von benachteiligten Menschen angegangen", sagte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie dem Science Media Center.
In krisenhaften Zeiten können sich all diese Faktoren verschärfen und dazu beitragen, dass es Menschen psychisch deutlich schlechter geht. Sozioökonomisch schlechter gestellte Menschen sind dafür eher anfällig, das stellten Forscher zum Beispiel nach der Finanzkrise 2008 fest. Und auch die Ergebnisse der aktuellen Studie lassen sich wohl am ehesten dadurch erklären: mit den Krisen der vergangenen Jahre.
Die Daten des RKI liefern zwar keine Gründe, warum sich die psychische Belastung so zugespitzt hat, gerade bei sozial benachteiligten Menschen. Die Autorinnen und Autoren äußern aber Vermutungen: Wenn man auf die Jahre zurückschaut, haben gleich mehrere Zäsuren den Alltag der Deutschen geprägt. Zunächst die Coronapandemie, während der Menschen ihre Jobs verloren, in Kurzarbeit gingen und ihre Kinder zu Hause betreuen mussten, weil Schulen und Kitas zeitweise geschlossen waren. Ab 2022 kam der russische Angriffskrieg in der Ukraine dazu, der bei vielen Menschen Sorgen auslöste, dazu kamen rapide steigende Energiekosten und Lebensmittelpreise. "Schulden, Existenza?ngste sowie Geldmangel sind Risikofaktoren fu?r Depressionen oder Angststo?rungen", sagt Nico Dragano. "Wa?hrend der Pandemie und spa?ter wa?hrend der Zeit starker Inflation sind diese Belastungen ha?ufiger geworden, was den Trend mit erkla?ren ko?nnte."
Das Tragische dabei: Menschen, die wenig Geld haben, sind diesen Einflüssen oft ausgesetzt, ohne etwas dagegen tun zu können. "Wir sprechen hier von sogenannten 'sozialen Determinanten der Gesundheit', die man selbst kaum beeinflussen kann", sagt Verina Wild, Leiterin des Instituts für Ethik und Geschichte der Gesundheit in der Gesellschaft an der Universität Augsburg. Der Haushalt, in den man hineingeboren wird, das Viertel, in dem man aufwächst, die Unterstützung, die man während der Schule bekommt, die Wohnung, die man sich als Erwachsener leisten kann, die Zeit, die für Self-Care und Auszeiten bleibt: All das sind Faktoren, die für viele Menschen oft schon in der Kindheit vorgezeichnet sind und die in der Regel außerhalb des eigenen Handlungsspielraums liegen. "Eigenverantwortung und individuelle Gesundheitskompetenz kommen da ganz klar an ihre Grenzen", sagt Wild.
Letztlich bedeutet das: Wenn sich die Lücke wieder verkleinern soll, muss vor allem die Politik handeln, da sind sich Fachleute einig. Es sei eine gesamtgesellschaftliche und politische Aufgabe, die Verhältnisse zu verbessern, in denen wir leben, sagt Verina Wild. "Also zum Beispiel Wohnungen und Wohnumgebungen, Arbeitsplätze, Freizeitangebote, soziale Anbindung, gegenseitige Anerkennung und Wertschätzung." Und Nico Dragano sagt: "Wir fordern schon seit Jahren, dass sich Deutschland eine echte Strategie zur Reduktion gesundheitlicher Ungleichheit gibt. Ideen wären da, nur die Umsetzung erfolgt nicht."
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1443 16-10-25: Im internationalen Vergleich der Wirtschaftsentwicklung rangiert Deutschland für 2025 auf dem vorletzten Platz

Wirtschaftlich ist Deutschland definitiv derzeit fußkrank. Mit nur -0,1 % für die in 2025 vom IWF erwartete BIP-Entwicklung nimmt Deutschland den vorletzten Platz ein (Abb. 30214).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1442 15-10-25: Neuer Höchstwert an Treibhausgas in der Erdatmosphäre
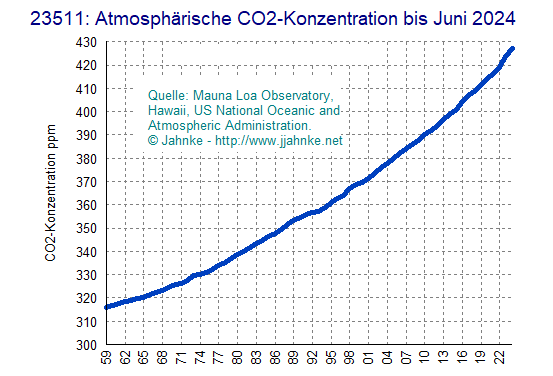
In der Erdatmosphäre ist die CO2-Konzentration UN-Experten zufolge im Jahr 2024 um einen Höchstwert angestiegen (Abb. 23511). Es handelt sich um den höchsten innerhalb eines Jahres registrierten Anstieg seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1957, wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) mitteilte. Höchstwerte habe es auch beim Gehalt an Methan und Distickstoffmonoxid (Lachgas), ebenfalls wichtige Treibhausgase, gegeben.
In den 1960er-Jahren lag der CO2-Anstieg pro Jahr laut WMO bei 0,8 ppm (Teilchen pro Million Teilchen). Zwischen 2011 und 2020 betrug der jährliche Anstieg bereits durchschnittlich 2,4 ppm. Von 2023 auf 2024 stieg die Konzentration dann um 3,5 ppm. Die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre lag 2024 insgesamt bei 423,9 ppm.
Neben den von Menschen verursachten Treibhausgasen seien auch Wald- und Buschbrände ein Grund für den Konzentrationsanstieg von CO2. Gleichzeitig sinkt laut WMO die Aufnahmefähigkeit von CO2 in Wäldern und Ozeanen. Das sei selbst eine Folge des Klimawandels. Ein Teufelskreis drohe.
Die Problematik verschärfte sich im vergangenen Jahr durch das alle paar Jahre auftretende Wetterphänomen El Niño. Das sorgt für mehr Dürren und Waldbrände. Bei Dürren können Ökosysteme weniger CO2 aufnehmen.
Das Pariser Klimaabkommen von 2015 sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Im besten Fall sogar auf 1,5 Grad. Aber solange die Menschheit weiterhin Treibhausgase produziert, zum Beispiel durch die Nutzung fossiler Energieträger wie Erdöl und Erdgas, nimmt deren Konzentration in der Erdatmosphäre zu. Das sorgt für einen weiteren Temperaturanstieg.
Laut WMO geht die Erderwärmung zu 64 Prozent auf den Ausstoß von CO2 zurück. CO2 ist das häufigste Treibhausgas und wird nur sehr langsam abgebaut. Auch nach 1.000 Jahren sind dem Bundesumweltamt zufolge noch immer etwa 15 bis 40 Prozent vom ausgestoßenen CO2 in der Atmosphäre übrig. Der gesamte Abbau dauert mehrere Hunderttausend Jahre.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1441 15-10-25: Warum eigentlich keine Vermögenssteuer in Deutschland?


1997 wurde die Vermögenssteuer von der CDU/FDP-Regierung ausgesetzt. Die damalige schwarz-gelbe Bundestagsmehrheit wollte die Vermögenssteuer seinerzeit gleich abschaffen und verhinderte eine Neuregelung der Grundbesitzbewertung, die anschließend nur für die Erbschaftsteuer erneuert wurde. Daher wird die Vermögenssteuer seit 1997 nicht mehr erhoben. Im diesjährigen ARD-Sommerinterview erteilte Bundeskanzler Friedrich Merz eine klare Absage: "Die Vermögensteuer kommt gar nicht, (...) weil jede Form der Vermögensteuer gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt."
Man braucht kein Genie zu sein, um nachzuvollziehen, warum ein Friedrich Merz gegen eine Vermögensteuer ist. Zwar erklärte er 2018 in einem Interview, sich selbst zur Mittelschicht zu zählen: "Wenn ich ›Oberklasse‹ oder ›Oberschicht‹ höre, denke ich an Menschen, die viel Geld oder eine Firma geerbt haben und damit ihr Leben genießen. Das ist bei mir nicht der Fall." Aber ob nun Mittel- oder Oberschicht, klar ist: Merz hat sehr viel mehr Geld als die meisten Menschen in Deutschland, deren Kanzler er ist. Ungefähr auf zwölf Millionen Euro wird sein Vermögen geschätzt. Angesammelt unter anderem durch diverse Aufsichtsrat- und Lobbytätigkeiten für Konzerne wie Axa, Commerzbank oder den US-Vermögensverwalter Blackrock. Dass Merz und sein Netzwerk keine Lust auf höhere Steuern haben, ist also wenig überraschend.
Aber bei den Fakten sollten wir schon bleiben. Die Vermögensteuer ist nämlich gar nicht verfassungswidrig. Im Gegenteil - sie steht sogar im Grundgesetz. 1922 kam das Vermögensteuergesetz. Es erhob eine regelmäßige Steuer auf hohe Vermögenswerte, zu denen neben Geld auch Immobilien und Grundbesitz sowie Luxusgüter wie etwa Kunst oder Schmuck zählten. Diese Steuer wurde seitdem jahrzehntelang erhoben - bis das Bundesverfassungsgericht 1995 urteilte: "Die Bemessungsgrundlage muss sachgerecht bezogen sein und deren Werte in ihrer Relation realitätsgerecht abbilden." Denn während das Geldvermögen real besteuert wurde, wurde der Wert von Immobilien und Grundbesitz anhand von Tabellen ermittelt. In Westdeutschland stammten diese aus dem Jahr 1964, in Ostdeutschland aus dem Jahr 1935. Dadurch wurde nur ein Bruchteil der tatsächlichen Marktwerte steuerlich erhoben.
Die Richter forderten also die Regierung auf, eine Grundlage zu entwickeln, nach der Vermögenswerte gleich besteuert werden. Doch der damalige Bundestag unter schwarz-gelber Mehrheit verhinderte eine Anpassung des Gesetzes. Seitdem ist nichts mehr passiert. Nun, seit dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer neu erhoben. Sie basiert nicht mehr auf einem Einheitswert, sondern auf einem Grundsteuerwert. Durch diese Änderung wäre die Vermögensteuer wieder verfassungskonform.
Und so nimmt das Vermögen der Vermögenden - von keiner Steuer behelligt - immer mehr zu (Abb.).
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1440 14-10-25: Hartnäckige Inflation in Deutschland
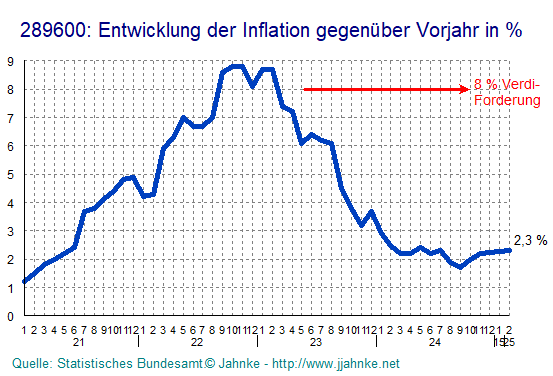
Die Inflation in Deutschland ist auch im September gestiegen und damit den zweiten Monat in Folge. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um durchschnittlich 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte (Abb. 289600). Dies ist der höchste Wert seit Dezember. "Die Teuerung ist hartnäckiger, als viele erhofft haben", sagte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Dies liege vor allem an deutlich gestiegenen Lohnkosten, weshalb die Preise für Dienstleistungen stark zulegten. Erneut billiger wurde Energie: Sie kostete im September 0,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (August: -2,4 Prozent). Dienstleistungen verteuerten sich im Schnitt spürbar um 3,4 Prozent (August: +3,1 Prozent). Aus geldpolitischer Sicht dürfte nicht so sehr der Anstieg der Gesamtinflation beunruhigen", sondern vielmehr die anziehende Teuerung bei Dienstleistungen.
Nominal stiegen die Löhne im 2. Quartal 2025 um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahresquartal.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1439 13-10-25: Gallup: State of the World's Emotional Health Connecting Global Peace, Wellbeing and Health: Steigende Sorgen



Gallup: State of the World's Emotional Health Connecting Global Peace, Wellbeing and Health
Key Findings: A Decade of Distress • Negative emotions remain high. In 2024, 39% of adults worldwide reported experiencing a lot of worry the previous day, and 37% said the same about stress. Fewer said they experienced daily physical pain (32%), sadness (26%) and anger (22%). All are higher than they were a decade ago. • Positive emotions are steady. Feeling treated with respect (88%) reached one of the highest levels Gallup has measured. Daily experiences of laughter, enjoyment and feeling well-rested held at long-term averages, while learning something interesting the previous day dipped slightly but remains higher than it was a decade ago. • Peace shapes emotions. Sadness, worry and anger were more common in less peaceful countries as measured by the GPI, while anger, sadness and physical pain were higher where the PPI is weaker. Positive emotions such as enjoyment and feeling respected were less common in countries with weaker scores on either index.Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1438 05-10-25: Israelische Luftschläge in Gaza

Gaza nach ständiger völkerrechtswidriger Bombardierung durch Israel.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1437 09-10-25: Oxfam-Bericht; Milliardäre in der EU werden immer reicher

Das Vermögen der Superreichen in der EU wächst immer schneller, zeigt ein Bericht. Allein im vergangenen Jahr gab es durchschnittlich alle neun Tage einen Milliardär mehr. Deutschland liegt im globalen Ranking auf Platz vier. Die Milliardäre in der Europäischen Union werden immer reicher. Wie die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam mitteilte, ist das Vermögen der Milliardäre in der EU in der ersten Jahreshälfte um 405 Milliarden Euro gewachsen. Im März 2025 lebten demnach in der EU 487 Milliardärinnen und Milliardäre, 39 mehr als ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr gab es damit durchschnittlich alle neun Tage einen Superreichen mehr in der Europäischen Union.
"Die reichsten 3600 Menschen in der EU besitzen so viel Vermögen wie die ärmsten 181 Millionen Menschen in der EU, was in etwa der Gesamtbevölkerung Deutschlands, Italiens und Spaniens entspricht", teilte Oxfam mit. Laut einem früheren Bericht von Oxfam gibt es weltweit inzwischen 2769 Milliardärinnen und Milliardäre - allein im vergangenen Jahr seien 204 neu dazugekommen. Gleichzeitig stagniere die Zahl der Menschen, die unter der erweiterten Armutsgrenze der Weltbank lebten, heißt es in dem Bericht über globale Ungleichheit. Und die Zahl hungernder Menschen steige.
Bei ihrer Auswertung kam die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation zu dem Schluss, dass die Welt innerhalb eines Jahrzehnts bereits fünf Dollar-Billionäre haben könnte. Im vergangenen Jahr sei das Vermögen der Milliardäre dreimal stärker gewachsen als noch im Vorjahr. Es sei von 13 auf 15 Billionen US-Dollar angestiegen. Deutschland hat dem Bericht zufolge die viertmeisten Milliardäre weltweit - nach den USA, China und Indien. Ihre Zahl stieg demnach im vergangenen Jahr um neun auf 130. Ihr Gesamtvermögen liege inzwischen bei 625,4 Milliarden US-Dollar.
Oxfam errechnete zudem, dass deutsche Milliardärinnen und Milliardäre überdurchschnittlich von Erbschaften profitieren. Während weltweit 36 Prozent des Milliardärsvermögens aus Erbschaften stammt, sind es hierzulande sogar 71 Prozent.
Die reichsten 3600 Menschen in der EU besitzen so viel wie die ärmsten 181 Millionen Menschen
Oxfam fordert, dass Vermögen stärker besteuert werden. Deutschland hat die Vermögenssteuer unter CDU/FDP-Regierung schon seit 1997 ausgesetzt.
Die Abbildung zeigt die sehr ungleiche Verteilung in Deutschland.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1436 08-10-25: 256 Milliardäre in Deutschland


Die Zahl der Milliardäre in Deutschland hat sich seit 2001 auf 256 vervierfacht (Abb.). 1997 wurde die Vermögenssteuer von der CDU/FDP-Regierung ausgesetzt. Das begünstigt den Zuwachs der Milliardäre.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1435 07-10-25: Man muß Israel wegen seines mörderischen Kriegs in Gaza kritisieren dürfen, ohne deswegen vom Merz als Antisemit verschrien zu werden

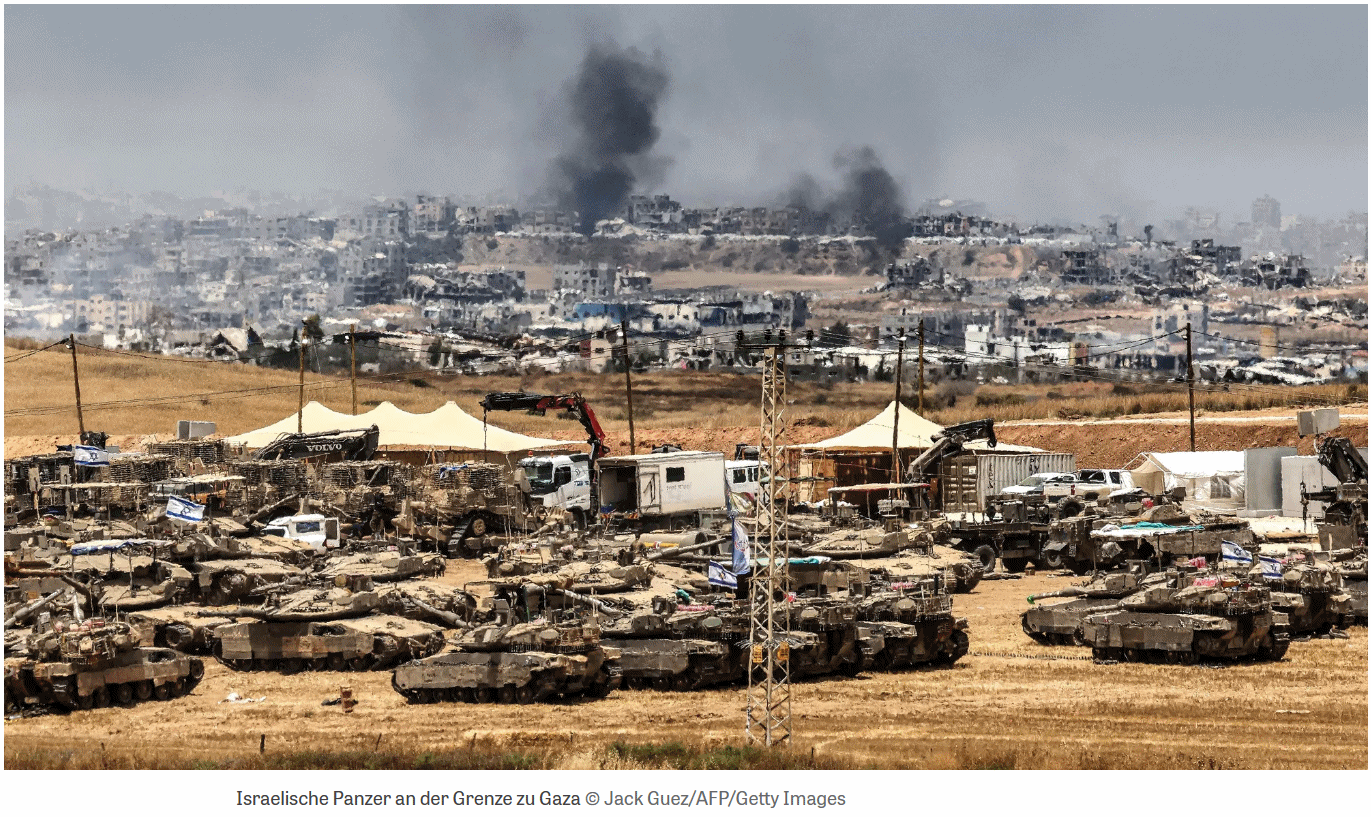
Bundeskanzler Friedrich Merz warnt angesichts des zweiten Jahrestags des Hamas-Überfalls auf Israel vor Antisemitismus in Deutschland. "Seit dem 7. Oktober 2023 erleben wir in Deutschland eine neue Welle des Antisemitismus. Er zeigt sich in altem und neuem Gewand - in den sozialen Medien, an den Universitäten, auf unseren Straßen; immer lauter, immer unverschämter und immer öfter auch in Form von Gewalt", sagte der CDU-Politiker in einer Videobotschaft. Das ist ziemlich einseitig und lenkt bewußt von dem mörderischen Gegenangriff Israels ab. Bei den israelischen Militäroperationen im Gazastreifen wurden laut Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza und der Vereinten Nationen über 60.000 Bewohner getötet und zehntausende weitere schwer verletzt; Experten sehen die offiziellen Opferzahlen als konservative Schätzungen an. Bis Mitte Dezember 2023 mussten rund 1,9 der etwa 2,2 Millionen Einwohner Gazas ihre Häuser und Wohnungen wegen der Kämpfe verlassen und in ausgewiesene Evakuierungsgebiete fliehen. Dagegen ermordeten Terroristen der Hamas am 7. Oktober 2023 1139 Menschen, ein Bruchteil der von Israel bisher ermordeten 60.000.
Offensichtlich fällt es dem Bundeskanzler schwer, in Erinnerung an den deutschen Holocaust gegenüber den Juden von vor 65 Jahren die israelischen Morde von heute kritisch einzuordnen.
.Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1434 06-10-25: In Deutschland rund 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen
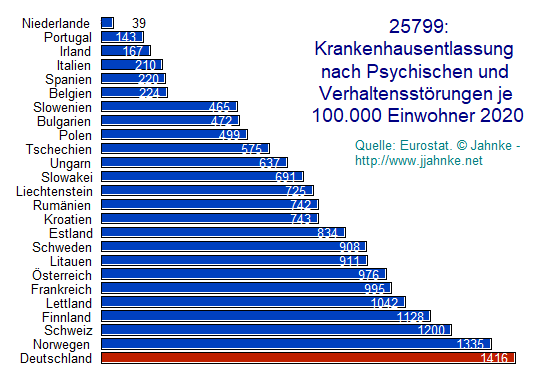
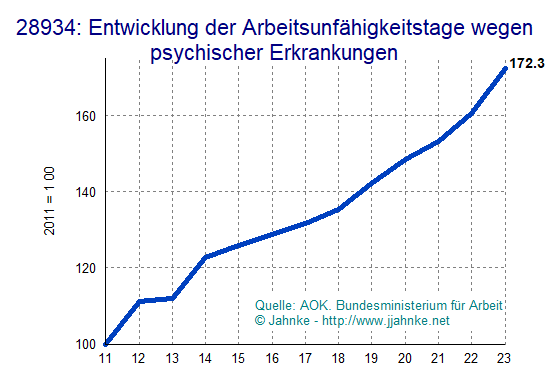
Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) ist die größte medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft Deutschlands im Bereich der psychischen Gesundheit. Laut ihren Erhebungen sind in Deutschland rund 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Das entspricht rund 18 Millionen Menschen. Mit gut 15 Prozent gehören Angststörungen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Nur knapp 20 Prozent der Betroffenen sind in professioneller Behandlung. Die anderen 80 Prozent sind ausschließlich auf die Unterstützung von Angehörigen, Freundinnen und Freunden, Partnern, Nachbarn oder Kolleginnen angewiesen. Menschen, die für diese Begleitung nicht ausgebildet wurden und damit häufig überfordert sind. Sie alle müssen mit den Auswirkungen der psychischen Erkrankung umgehen.
Schätzungen zufolge (PDF) leben in Deutschland mindestens zwei bis drei Millionen Kinder mit mindestens einem psychisch erkrankten Elternteil, davon ca. 500.000 bei schwer psychisch kranken Eltern. Die Dunkelziffer ist hoch. Andere Fachgesellschaften – etwa DGPPN oder der Forschungsverbund COMPARE-Projekt – nennen Zahlen von circa 3,8 bis 4?Millionen betroffenen Kindern, was etwa ein Viertel aller Kinder unter 18?Jahren entspricht. Professorin Silke Wiegand-Grefe leitet am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie die Forschungssektion "family research and psychotherapy", die neben anderen nationale und internationale Studien zur Kinder- und Jugendgesundheit durchführt. "Abhängig von der Art der psychischen Erkrankung von Vater oder Mutter zeigen unsere Studien, dass Kinder aus diesen Familien ein drei- bis siebenfach höheres Risiko tragen, im Laufe ihres Lebens selbst zu erkranken", sagt sie. Eine zentrale Forderung der Verbände ist es deshalb, dass Eltern, die in Behandlung sind, nach ihren Kindern gefragt werden.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1433 06-10-25: Schon mehr als 67.000
Palästinenser im Gazastreifen getötet


Am 7. Oktober 2023 verübten Hamas-Anhänger und andere Terroristen Massaker in Israel, bei denen rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Israel reagierte darauf mit einer Militäroffensive. Seit Kriegsbeginn wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde mehr als 67.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet. Zur Aufrüstung des israelischen Militärs hat such die deutsche Bundesregierung beigetragen. Se ist damit für die 67.000 Toten mitverantwortlich.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1432 06-10-25: Bei einer Branchenumfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bewerteten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Situation als "schlecht" oder sogar "sehr schlecht"
Bei einer Branchenumfrage des Verbands der Automobilindustrie (VDA) bewerteten knapp die Hälfte der befragten Unternehmen ihre Situation als "schlecht" oder sogar "sehr schlecht", wie der Verband mitteilte. Das wirkt sich auch auf Investitionen und Beschäftigung aus;
Mehr als 60 Prozent der Unternehmen wollen eigenen Angaben zufolge Stellen streichen.
Bei den Investitionen planen rund 80 Prozent, sie entweder zeitlich zu verschieben, ins Ausland zu verlagern oder ganz zu streichen.
Ein knappes Fünftel der Zulieferer bleibt bei den bisherigen Investitionsplänen, kaum jemand plant eine Erhöhung.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1431 05-10-25: Wirtschaftliche Stagnation und weiterer Absturz des Zustimmungswerts für die Union von Bundeskanzler Friedrich Merz auf nur noch 24 Prozent
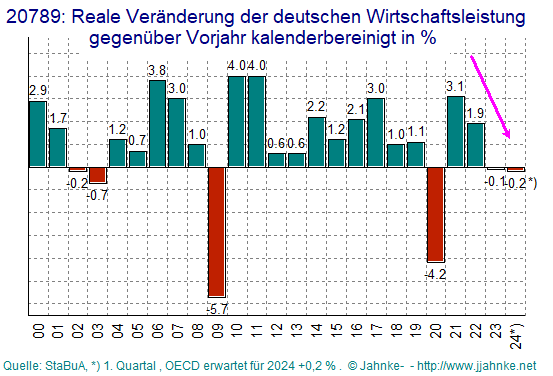
Die deutsche Wirtschaft stagniert schon im dritten Jahr (Abb. 20789). Da ist es kein Wunder, wenn in der Sonntagsumfrage der Zustimmungswert für die Union von Bundeskanzler Friedrich Merz auf nur noch 24 Prozent abgesunken ist, während die AfD ihre 26 Prozent aus der Vorwoche halten konnte und damit aktuell stärkste Kraft bleibt. Armes Deutschland!
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1430 04-10-25: Unser Pflegesystem krankt schwer

Die finanziellen Anforderungen im Pflegesystem wachsen rasant. Galten 2010 rund 2,5 Millionen Menschen in Deutschland als pflegebedürftig, waren es Ende 2024 rund sechs Millionen, knapp 400.000 davon in der privaten Pflegeversicherung. Reichten 2010 noch 20 Milliarden Euro für die gesetzliche Pflegeversicherung, so waren es 2024 bereits die erwähnten 68 Milliarden Euro. 12,8 Milliarden davon für die Kosten der Unterbringung in Heimen und noch einmal 6,5 Milliarden Euro zur Senkung des Eigenbeitrags als zusätzliche Unterstützung für die Heimbewohner.
Die zusätzliche Unterstützung ist auch dringend erforderlich, denn ein Heimplatz kostet in Deutschland aktuell oft über 6000 Euro im Monat. Nimmt man alle Hilfen der Pflegeversicherung in Anspruch, liegt der Eigenanteil der Pflegepatienten im Schnitt bei gut 3000 Euro. Vor fünf Jahren waren es noch knapp 2000 Euro. In Baden-Württemberg und NRW ist das Ganze noch teurer, hier liegt der Eigenanteil bei 3700 Euro im Schnitt. Das ist für normale Menschen aus den laufenden Einnahmen nicht bezahlbar.
Die drastischen Preissteigerungen haben sich herumgesprochen. Immer mehr Pflegebedürftige versuchen zu Hause zu bleiben, das Heim zu vermeiden. Sie erhalten dann Pflegegeld von der Kasse, das sie an Angehörige oder Freunde ohne Einschränkung weitergeben können. Für solche Hilfen von der Kasse müssen Sie aber einen Pflegegrad beantragen. Dann kommt der Medizinische Dienst der Krankenkasse zur Prüfung. Beim Pflegegrad 1 gibt es noch kein frei verfügbares Geld, sondern nur einen Entlastungsbeitrag, mit dem Sie beispielsweise eine zertifizierte Putzfirma bezahlen können, ohne dass das Geld auf Ihrem Konto landet. Einen Musterantrag finden Sie hier.
Der Anteil der Pflegebedürftigen, die zu Hause gepflegt werden, ist inzwischen auf 86 Prozent gestiegen. In den Heimen leben vor allem schwer pflegebedürftige und demente Senioren mit hohen Pflegegraden, deren Alltag in der eigenen Wohnung schwer zu bewältigen ist. Die Verweildauer, also die Zeit vom Eintritt ins Heim bis zum Tod schrumpfte deswegen in den vergangenen Jahren von 28 auf zuletzt 25 Monate.
Eigentlich müsste zu Hause bleiben auch aus Sicht der Pflegeversicherung eine probate Strategie sein. Schließlich ist es für die Pflegekasse preiswerter, wenn ein schwer pflegebedürftiger Mensch zu Hause mit knapp 1000 Euro im Monat unterstützt wird, statt mit 2100 Euro und weiteren Zuschüssen im Heim.
Aus dieser Sicht ist es also vernünftig, alles zu tun, damit möglichst viele Menschen in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können und dort gut versorgt werden können. Jeder Einsparvorschlag sollte an diesem Maßstab gemessen werden. Karenzzeiten oder der Wegfall von Pflegegrad 1 adressieren dieses Problem nicht .
Andersherum - wenn man fürs Daheimbleiben etwa den alters- und pflegegerechten Umbau der Wohnung fördern will, ist es sicher gut, das früh in der Pflegekarriere zu tun. Bodengleiche Duschen und Handläufe an den richtigen Stellen sorgen einfach für weniger Unfälle im Haushalt. Und weniger Unfälle für weniger schwer Pflegebedürftige. Für Ehepaare sind bei einem solchen Umbau inzwischen auf einen Schlag 8360 Euro Förderung drin. Keine Bereicherung: Das Geld landet beim Klempner und Fliesenleger.
Wichtig: Mit Pflegegrad 1 haben Bürgerinnen und Bürger auch den Anspruch auf eine ausführliche Pflegeberatung, die ihnen wirklich helfen kann. Für Angehörige ist das vielleicht das Wichtigste zum Start. Ich spreche aus Erfahrung. Das ist hier also ein Plädoyer gegen die ersatzlose Streichung von Pflegegrad 1.
Und ein Plädoyer, das Pflegen zu Hause einfacher und besser mit dem Alltag der Pflegenden kompatibel zu machen. Wer während seiner Berufstätigkeit Angehörige oder Freunde zu Hause pflegt, bei dem können sich die Pflegebedürftigen mit dem entsprechenden Pflegegeld erkenntlich zeigen. Zusätzlich gibt es für diese Pfleger/innen Punkte bei der Rentenversicherung, de facto eine Extra-Rente. Mehr Rente ist sogar drin , wenn Sie aktuell schon in Rente sind. Dazu muss Ihre Pflegerin der Rentenversicherung nur mitteilen, dass sie für die Zeit der Pflege in Teilrente geht, also beispielsweise auf 0,1 (!) Prozent Ihrer Rente verzichtet. Nach einem Jahr intensiver Pflegetätigkeit kann die Rente anschließend durchaus um 30 Euro gestiegen sein. Insgesamt zahlt die Pflegeversicherung heute schon vier Milliarden Euro vor allem in die Rentenkasse.
Darüber hinaus gibt es jede Menge Hilfen, die aber oft nicht in Anspruch genommen werden. Die beiden wichtigsten Punkte vielleicht: Mit Mitteln für eine Kurzzeit- und Verhinderungspflege können Sie Ihre Betreuung auch sicherstellen, wenn Ihre Pflegeperson krank wird oder auch mal in den Urlaub möchte. 3539 Euro im Jahr stehen dafür zur Verfügung. Bezahlt wird aber nur die Pflege, weder die Unterkunft noch die Verpflegung noch die Immobilienkosten und Ausbildungspauschale im Heim. Neben der Kurzzeitpflege gibt es für die kleinen Fluchten des Alltags noch die Möglichkeit zur Tagespflege. Dort werden Pflegebedürftige von morgens bis abends betreut und können mit anderen ihre Freizeit teilen. Ihre normale Pflegeperson kann derweil dem eigenen Alltag nachgehen.
Zu Hause zu leben kann preiswerter sein. Aber wenn man über Einsparungen spricht, muss es natürlich auch um die Anbieter von Pflegeleistungen gehen. Notwendige Leistungen sollten erhalten bleiben, die Kosten langfristig verringern. Am einfachsten schaut man sich dafür die Rechnungen eines Pflegeheimes an. In den vergangenen Jahren hat sich dort Erstaunliches getan. Seit 2022, zuletzt 2024, hat die Bundesregierung die Hilfen für Menschen deutlich erhöht , die länger in einem Pflegeheim leben. Kaum geschehen, erhöhten sich jeweils auch die von den Einrichtungen berechneten Pflegekosten drastisch. Für eine Pflegebedürftige im Pflegegrad 5 hat mein Beispielheim 2024 die monatlichen Pflegekosten um schlappe 25 Prozent erhöht, 825 Euro mehr im Monat. Die pauschalisierten Kosten für die Ausbildung von Pflegekräften erhöhten sich gleichzeitig auch um 25 Prozent, von 151 auf 210 Euro im Monat und die "Hotelkosten" (also Unterkunft und Verpflegung im Pflegeheim) stiegen von 1187 auf 1288 Euro im Monat - nix mit Mietpreisbremse. Beim Vergleich verschiedener Heime kann man deutliche Unterschiede bei der Pflege und auch bei den Hotelkosten sehen - auch innerhalb eines Bundeslandes. Effizienz geht anders. Mehr Kontrolle und Transparenz würden hier nicht schaden.
Noch unverständlicher: Neben ihren "Hotelkosten" zahlen Pflegebedürftige in Deutschland im Schnitt monatlich rund 500 Euro für den Aufbau des einschlägigen Immobilienvermögens bei den Trägern der Heime. Hinzu kommt noch einmal eine Milliarde an staatlicher Förderung für diese Bautätigkeit, gesponsort von den meisten Bundesländern .
Wie wird das alles aktuell bezahlt? Die Kosten der gesetzlichen Pflegeversicherung werden von den Beitragszahlern aufgebracht. Und diese Kosten sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, obwohl ja nur die Hälfte der Kosten im Pflegeheim so gedeckt wird. Lag der Beitragssatz 2020 noch bei 3,05 Prozent für Beitragszahler mit einem Kind, ist er inzwischen auf 3,6 Prozent vom Bruttolohn gestiegen. Ohne Kinder zahlt man sogar 4,2 Prozent. In Euro: Bei 4000 Euro brutto lag der Anteil früher bei 122 Euro, heute bei 144 und ohne Kinder sogar bei 168 Euro im Monat. Wer nach fünf Jahren 1000 Euro im Monat mehr verdient hat, dessen Beitrag erhöht sich entsprechend weiter - von 168 auf bis zu 210 Euro. Das Ganze wird direkt vom Lohn abgezogen. Für Nicht-Arbeitseinkommen, etwa aus Renditen oder Gewinnen, gibt es hier bislang keine Beteiligung.
Damit Pflege künftig auch für Sie finanzierbar bleibt, sollten Sie sich wenn irgend möglich für Ihren Teil einen Pflegesparstrumpf zulegen. Davon gibt es aktuell drei Varianten: " Eine sogenannte Pflegezusatzversicherung, die Ihnen zusätzlich zur gesetzlichen Pflegeversicherung hilft, die teuren Pflegerechnungen zu begleichen. Pferdefuß dabei: Die Versicherer verlangen eine Menge Geld jeden Monat und Sie müssen dieses Geld auch in der Rente monatlich aufbringen können, sonst ist der Versicherungsschutz weg. Mit 50 bis 200 Euro im Monat sollten Sie beim Abschluss der Versicherung als Mittfünfziger schon rechnen - und Achtung, die Summe müssen Sie auch in der Rente weiter stemmen können. Einen Vergleich der unterschiedlichen Modelle finden Sie hier.
" Ein Depot oder Sparkonto mit 50.000 bis 80.000 Euro, das Ihnen hilft, die teuren Pflegerechnungen zu begleichen. Wenn Ihre Rente wenigstens für einen größeren Teil der Zuzahlung reicht, müssen Sie monatlich vielleicht nur 1000 oder 1500 Euro entnehmen, Ihr Strumpf reicht für dann für entsprechend viele Jahre .
" Ihre Immobilie als Vermögensrücklage. Das Dumme ist nur, die lässt sich aktuell noch schlecht scheibchenweise zu Geld machen, um die Pflegekosten zu tragen. Und doch liegt hier das größte Potenzial. Ungefähr die Hälfte aller Seniorinnen und Senioren verfügt über Wohneigentum und könnte es für die eigene Pflege einsetzen. Leicht wird dieser Einsatz uns und Ihnen aber bislang nicht gemacht.
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.
Blog 1429 04-10-25: Schuster und seine Klage über zunehmenden Antisemitismus

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland Schuster beklagt wachsenden Antisemitismus in Deutschland und neue Dimensionen des Judenhasses: "Es ist auch eine Zeit, in der Jüdinnen und Juden - auch in Deutschland - sich häufig alleine fühlen und dabei tief verwurzelte Traumata geweckt werden. Die Einsamkeit war so oft eine existentielle Erfahrung für Juden. Der beispiellose Anstieg antisemitischen Hasses verstärkt dieses uns generationsübergreifend so vertraute Gefühl der Einsamkeit und der Isolation."
Doch warum beklagt Schuster nicht vor allem die Gründe für wachsenden Antisemitismus, nämlich den Völkermord Israels in Gaza? Stattdessen nennt er die Stellungnahmen aus der SPD-Bundestagsfraktion zur Situation in Gaza in ihrer Einseitigkeit verstörend. Mit den einseitigen Schuldzuweisungen an Israel ignorierten sie die Realität im Nahen Osten.
Wie kann sich Schuster angesichts des völkermordenden Verhaltens Israels über zunehmenden Antisemitismus wundern?
Sie können gerne per Mail an globalnote40@gmail.com antworten.